Wendehammer
Greta 2012
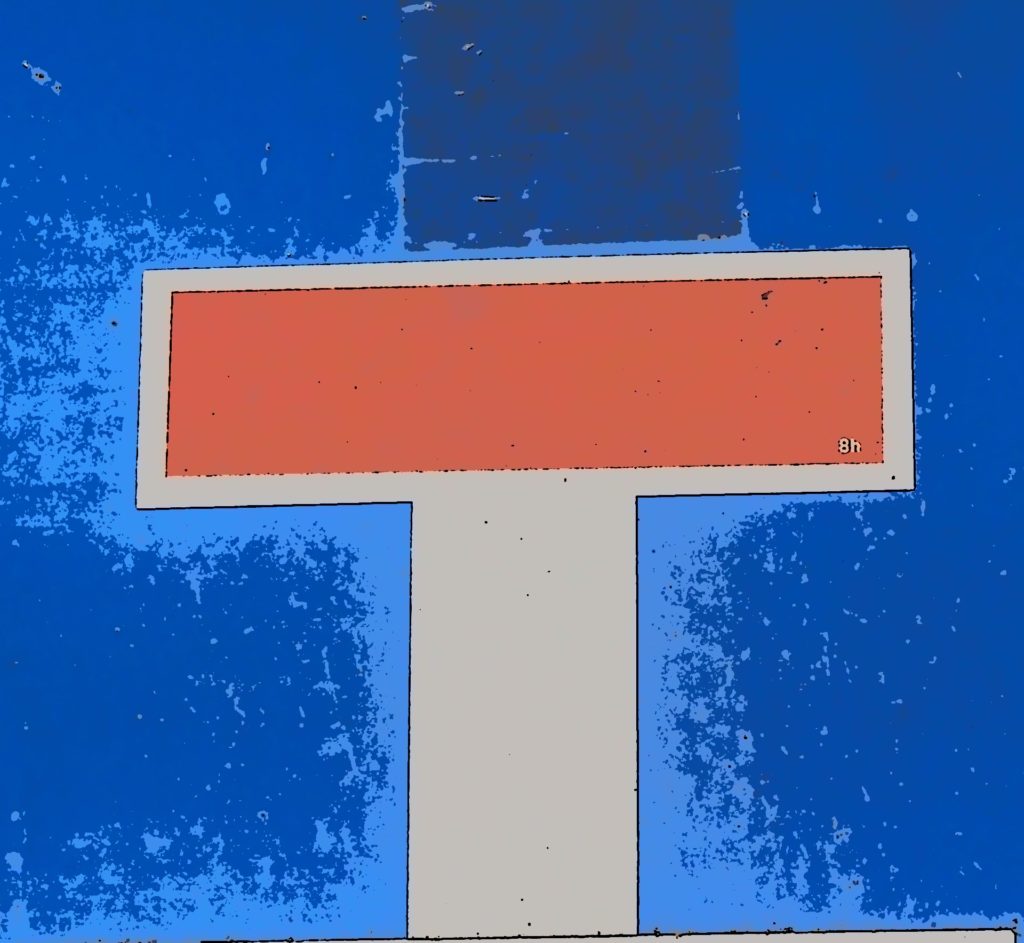
Als meine Tochter 10 Jahre alt war, habe ich sie verlassen. Ich kehrte einen Tag später zurück, aber sie konnte es mir nie mehr verzeihen. Mit 11 Jahren hat sie mich verlassen. Beide Ereignisse habe ich nie verwunden. Ein Messer bohrte sich in meinen Rücken und verursacht seitdem tägliche Schmerzen. Meine Selbstverachtung wuchs von Tag zu Tag und löste mein inneres ICH auf.
Jeder einzelne von uns trägt in sich das Vermächtnis seiner Vorfahren. All ihre erlebten Stunden prägen auch unser Dasein auf dieser Welt, obwohl wir selbst nicht dabei waren. Jede Sekunde, die wir leben, fügen wir dem Bild neue Eindrücke hinzu. Dadurch bekommt es eine andere Färbung, aber das Bild bleibt das Gleiche.
Wir wollen im Hier und Jetzt leben, doch in jedem einzelnen Moment spüren wir unsere Vergangenheit wie einen schweren Rucksack und die Ungewissheit der Zukunft lauert uns auf. Und so zerrinnen die Momente unseres Lebens, wie die Körner in einer Sanduhr hinabrauschen.
Mit meinem 45. Geburtstag stellte ich erstmals fest, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr als die Hälfte meines Lebens vorbei war. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Wo bin ich, wo will ich hin? In einer alten Sparkassen- Werbung der 80er Jahre sieht eine Bestandsaufnahme so aus: mein Haus, mein Auto, mein Boot… Bei mir sah es etwas anders aus: Ich hatte eine Tochter (wunderbar), eine Fernbeziehung (Prädikat nicht empfehlenswert), einen Kindsvater (mehr ist von ihm leider nicht übrig geblieben) und einen Ex- Mann (nicht identisch mit dem Kindsvater). Dazu ein Haus, das so klein war, dass es allenfalls für Puppen eine Villa wäre und wenige, die Betonung liegt auf wenige, Bekannte. Freunde – Fehlanzeige.
Im Sommer 2010 hatte ich mich in eine Sackgasse manövriert und der Wendehammer war verdammt eng.
Äußerlich betrachtet war alles perfekt. Mit Sebastian, dem Kindsvater, und unserer Tochter Jette hatte ich eine Familie, wir lebten in dem Puppenhaus und beruflich hatte ich mich gerade selbständig gemacht. Aber für mich stimmte nichts. Mein Beruf fraß mich auf. Ich schaffte es nicht, zu meiner Tochter eine innige und liebevolle Beziehung aufzubauen. Ich war nicht in der Lage, Freundschaften aufzubauen. Schlimmer noch, soziale Kontakte außerhalb meines Berufslebens waren für mich der pure Stress. Ich steckte in einer unglücklichen Beziehung fest. Zig mal schaute ich Sebastian an und fragte mich, was so verdammt falsch an ihm war. Er hatte mich nie im Stich gelassen, war immer für mich da, sah gut aus und war nebenbei auch ein sehr liebevoller Vater meiner Tochter. Wo verdammt war das Problem?
Sebastian und ich hatten uns einfach verloren. Es war keine Absicht. Es gab keinen Streit. Es passierte einfach so. So wie man nach jedem Waschmaschinengang arme, verwaiste Socken vorfindet. Man steckt sie als Paar in die Waschmaschine und beim Sortieren der gewaschenen Wäsche fehlt eine Socke. Immer nur eine. Sie verschwinden nie als Paar. So etwa lief das bei Sebastian und mir. Wir starteten als Paar in den Alltag und ohne es zu merken, verloren wir uns.
Während es ihm gelang, zu unserer Tochter Jette eine innige Beziehung aufzubauen, gelang mir dies nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte zu ihr keine Nähe herstellen. Ich war eine Mutter ohne mütterliche Gefühle.
So befand ich mich in meiner tiefsten Krise. Zumindest dachte ich das damals. Es sollte alles noch viel schlimmer kommen, aber das wußte ich damals noch nicht. Damals hatte ich mich verloren. Weder das Wann und Wo noch das Warum war mir klar. Ich befand ich mich im freien Fall und fiel immer weiter und tiefer. Wie in einem der ekligen Albträume, aus denen man irgendwann schweißgebadet aufwacht. Nur, dass ich nicht mehr aufwachte.
Obwohl ich mein Leben damals unerträglich fand, konnte ich doch nicht ausbrechen. Ich konnte nicht einmal darüber nachdenken, so sehr Angst machten mir solche Gedanken. Jegliche Überlegungen über ein freies und selbstbestimmtes Leben ließ ich einfach nicht zu. Schlimmer noch, ich hatte einfach keinerlei Idee, wie ein freies Leben aussehen könnte.
Während ich das schreibe, sitze ich an einem warmen Herbsttag bei geöffneten Türen am Schreibtisch. Noch wärmende Sonnenstrahlen fluten den Raum und von draußen strömen die Geräusche der Nachbarschaft herein. Irgendwer mäht den Rasen, irgendwo spielen Kinder und lachen. Eine große grüne Libelle, wunderschön glänzend, hat sich nach innen verirrt und zappelt am Fenster entlang. Ich will ihr zeigen, wo es wieder rausgeht. Flieg raus, du schöne Libelle, denke ich. Denn hier drinnen wirst du nur sterben. Draußen bleiben dir noch ein paar schöne Tage des Spätsommers. Aber sie lässt sich nicht beirren. Und irgendwo stirbt in diesem Moment ein Mensch.
Ich wurde am Ostermontag 1967 geboren. Es war ein kaltes Osterfest, draußen lag Schnee und ein eisiger Wind wehte über die kleine Stadt hinweg. Für die kommende Nacht war eine Sturmflut vorhergesagt worden. Das alles schien mich hervorzulocken, und so setzten bei meiner Mutter Margarete, genannt Marga, die Wehen ein. Voller Aufregung fuhren meine Eltern sofort ins Krankenhaus. Dort angekommen wurden sie erst einmal auf die Treppe geschickt. „Die Stufen immer schön herunter springen. Ihr Mann soll sie gut festhalten. Immer wieder rauf und runter. Wir müssen etwas Bewegung in die Sache bringen.“ Das waren die Anordnungen des diensthabenden Gynäkologen. Damit begann der erste Teil der Entbindung. Der Part, an dem der werdende Vater Hermann noch teilnehmen durfte. In den Kreißsaal durfte er nicht mit hinein. Es war ein großer, grüngekachelter Raum, in dessen Mitte unter einer großen OP- Lampe ein gynäkologischer Untersuchungsstuhl stand. Die Lampe gab ein kaltes Licht ab. Zu den quälenden Wehen gesellten sich Angst und das Gefühl, völlig allein zu sein. Aber irgendwann schwemmten die Schmerzen der Wehen die Angst einfach weg.
Kaum hatte ich das Licht der Welt erblickt, riß mich Hebamme Agnes an sich, um mich zu waschen, zu vermessen und in ein weißes Leibchen zu hüllen. Erst dann bekam Marga mich kurz zu sehen. Aber nur kurz. Sofort danach verfrachtete man mich in einen gläsernen Säuglingswagen und brachte mich in das Neugeborenen- Zimmer. Dort konnte mich mein Vater hinter einer Glasscheibe aus der Ferne bewundern.
Meine Mutter und ich schliefen im Krankenhaus, wie damals üblich, selbstverständlich getrennt. Zur festgelegten Fütterungszeit brachte mich Hebamme Agnes in meinem Glas- Porsche zu meiner Mutter. Noch nicht an mich gewöhnt, war meine Mutter sehr aufgeregt, wenn ich schreiend ins Zimmer gefahren wurde.
Meine Mutter erinnerte sich in unserem Gespräch, als ich sie zu meiner Geburt befragte, dass sie damals sofort verkrampfte. Sie habe sich von der Verantwortung, mich alleine satt bekommen zu müssen, erdrückt gefühlt. Hebamme Agnes hielt nicht viel vom Stillen. Ihrer Meinung nach würden die Kinder nicht ausreichend satt werden und schrieen viel länger und häufiger als nach der Flasche. Und so würden die Stillkinder mehr Arbeit verursachen, vor allem die Nächte seien viel anstrengender. Genau genommen hasste sie das Stillen. Der Anblick der nackten, prallen Brüste war ihr peinlich. Entsprechend mürrisch legte sie mich an die Brust meiner Mutter, nachdem diese ihr Nachthemd aufgeknüpft hatte.
Auf den Schmerz, den mein Saugen an ihrer Brustwarze auslöste, war meine Mutter nicht vorbereitet. Ein ziehender Schmerz, der durch Mark und Bein ging. Marga verkrampfte noch mehr. Wahrscheinlich bekam ich nicht genug Milch und begann zu weinen. Agnes presste den Kopf wieder an die Brust, die nächste Schmerzwelle rollte an. Dann verlor Agnes die Geduld und beendete den Prozess. „Wir probieren es morgen wieder“.
Aber da auch beim Stillen das Angebot die Nachfrage regelt, wurde ich wohl tatsächlich nie satt. Also ließ sich meine verzweifelte und von Selbstvorwürfen zerstörte Mutter von Agnes überzeugen, dass die Flaschennahrung für mich das Beste sei.
Während meine Mutter mir diese Erlebnisse vor wenigen Jahren schilderte, spürte ich, dass sie sich noch immer Versagen vorwarf. Ich konnte sie nicht trösten – soviel Nähe war nicht möglich. Vielleicht habe ich es mit meinen Abnabelungsprozessen und Distanzierungsversuchen so übertrieben, dass sich keine Nähe mehr heraufbeschwören ließ.
Seit meinem 29. Lebensjahr leide ich an der scheußlichen Krankheit namens Depression. Diese unerträgliche bedrückte Stimmung, die ständig vorhanden ist. Ein Eispanzer hatte sich über mich gelegt, gefror mein Herz und ist immer noch nicht getaut. Diese Unfähigkeit zur Freude, gepaart mit einer ewigen innere Unruhe, als würde ich ständig unmittelbar vor einer Operation am eigenen offenen Herzen stehen. Und sollte gerade einmal ein kurzer Moment der Glückseligkeit eintreten, schlägt die Depression gerade in diesem Moment unbarmherzig zu. Eisblumen statt Sonnenblumen. In der Öffentlichkeit muss ich eine Maske der Unbeschwertheit aufsetzen, was mir alle Kraft bis zur völligen Erschöpfung abverlangt. Deshalb mag ich Christo. So wie er den Reichstag verhüllte, muss auch ich mich ständig verhüllen.
Eine Frage, die mich immer wieder quält, dreht sich darum, ob die Depression wirklich erst mit 29 Jahren begonnen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht doch mein ganzes Leben von Angst und Einsamkeit geprägt ist. War ich jemals ein lustiges und frohes Kind? Beim Heraufbeschwören der Erinnerungen, die leider nicht ihre Kraft verlieren, tauchen immer wieder Bilder auf, die mich erschüttern.
Ich komme aus einem wohlbehüteten Elternhaus. Ich war so wohlbehütet, dass ich kaum Raum für meine eigene Entfaltung hatte. Dies wurde mir Jahre später deutlich, als meine Eltern bei uns zu Besuch waren. Jette war anderthalb Jahre alt war. Sie spielte völlig vertieft und zufrieden mit einem kleinen Ball und einem Esslöffel, bis meine ihr Mutter beides aus der Hand nahm und ihr nahe legte, Eierlaufen zu spielen. Jette hatte sofort jegliches Interesse an dem Ball und dem Löffel verloren, ihr schönes Spiel war zerstört und sie begann sich zu langweilen. Auch mir schrieb meine Mutter immer vor, was ich wie zu machen hatte. Wollte ich etwas anderes, war sie gekränkt und reagierte mit Liebesentzug. Bis ich nur noch machte, was sie wollte. Ich malte Bilder, so wie sie es wollte. Ich trug die Klamotten, die sie schön für mich fand, auch wenn ich mich in der Schule dafür schämte. Tat ich es nicht, war sie so gekränkt, dass ich unter ihrer daraus resultierenden Trauer litt. Als meine Tochter im Kindergartenalter war, malten wir gemeinsam ein großes Bild mit einem Baum im Herbst. Ich musste all meine Beherrschung aufbringen, ihr nicht zu verbieten, in den Stamm die Farben Lila und Hellblau mit einzuarbeiten. Heute hängt das Bild über meinem Bett. Als wunderschöne Erinnerung. Und als Mahnung.
Das Zuhause meiner Kindheit war immer still. Ich bin ein Einzelkind. Das sagt wahrscheinlich schon genug aus. Auch wenn wir alle drei zu Hause waren, war es immer still. Ich hörte in meinem Zimmer Märchen- Platten. „Gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.“ Damals gab es noch Langspielplatten. Ich hatte einen kleinen Plattenspieler, den ich aber nie laut aufdrehte. Als wollte ich die Stille nicht zerstören. In Wirklichkeit lauschte ich mit einem Ohr immer nach der Stimmung meiner Mutter. Lauschte, ob sie weinte. Denn das tat sie oft. Am schlimmsten waren die Sonntage. Andere Familien machten Ausflüge. Wir waren zuhause, allein, jeder für sich. Meine Mutter in der Küche, dazu hörte sie sonntags immer klassische Musik. Natürlich auch leise. Mein Vater verbrachte sein Leben in seinem Arbeitszimmer. Ein typischer Workaholic. Er verließ sein Zimmer nur, wenn es hieß „Essen fertig“. Zu welcher Gelegenheit meine Eltern mich gezeugt haben, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich auf seinem Schreibtisch, als sich meine Mutter zufällig in sein Zimmer verirrte, um zu gucken, ob die Gardinen gewaschen werden müssen. Letztens haben wir festgestellt, dass mein Vater keine Märchen kennt. Mich wundert das nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mir jemals vorgelesen hat. Als dieses Thema zwischen uns zur Sprache kam, witzelte ich, dass er mir bestimmt immer aus dem Handelsblatt vorgelesen habe. Anstatt mich zu beschweren, versuchte ich mit einem Witz, die Schuld von ihm zu nehmen.
Ich lauschte nicht nur auf die Stimmung meiner Mutter, sondern ich wartete auch auf Geräusche meines Vaters. Wartete darauf, dass er endlich aus seinem Arbeitszimmer herauskam, um meine Mutter zu trösten. Natürlich tat er es nicht. Also ging ich zu meiner Mutter und versuchte sie, aus der trüben Stimmung herauszuholen.
Szenen dieser Art gibt es in meinem Erinnerungsschatz in Hülle und Fülle.
Und doch ist meine Mutter fürsorglich und liebevoll. Viele kleine Szenen geistern mir im Kopf herum, in denen sie mir nah ist. Ich sehe uns in der Küche stehen, ich als kleines Mädchen, wir schälen Äpfel. Sie kann die Äpfel so schälen, dass die Schale an einem Stück bleibt. Anschließend werfen wir die Schale hinter uns und versuchen zu erkennen, ob sie in einer Buchstabenform auf dem Boden gelandet ist. Dieser Buchstabe wäre der Anfangsbuchstabe des zukünftigen Ehemannes.
Sie bastelte viel mit mir, brachte mir Stricken und Häkeln bei und spielte mit mir Reisebüro oder Post.
Noch vor kurzem hätte ich meine Kindheit sogar als geborgen und behütet bezeichnet. Jahrelang hielt ich meine Mutter für meine beste Freundin und es hat lange gedauert, die traurigen Erinnerungen in Einklang zu bringen mit der Wahrnehmung, dass meine Kindheit behütet war. Das war sie. Wohl nur zu behütet. Und sie war geprägt von der Last, die meine Eltern wiederum mit sich tragen. Aufgebürdet von ihrer eigenen Geschichte.
Meine Eltern sind nicht schuldig an meiner Situation. Jedenfalls nicht im Täter- Sinne.
Meine Eltern Margaret und Hermann feiern in Kürze ihren fünfzigsten Hochzeitstag. Mein Gott, wie schafft man das? Wohl, indem man nicht ausbricht. Statt dessen ordnete sich meine Mutter ihrem Mann unter. Sie war nach dem Abitur 1956 auf dem Lette- Haus in Berlin. Offiziell nannte sich das Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiterin. Dort lernte sie, wie man einen Mann mit Anmut bekocht und versorgt. In der ARD- Serie „Die Bräuteschule“ habe ich im Vorspann Bilder von meiner Mutter im Lette Hause gesehen. Dort wurde auch die Säuglingspflege erlernte. Das, was sie im Lette- Haus erlernte, wandte sie bei mir an. Gefüttert wurde zu festen Zeiten. Alle vier Stunden. Ob ich Hunger hatte oder nicht. Schlief ich, wurde ich zum Füttern geweckt. Dafür zog Marga sich einen weißen, reinen Kittel an und gab mir die Flasche. Täglich wurde ich gewogen – die Waage steht noch heute in unserer Küche. Jeden Abend wurde ich gebadet. Nichts wurde dem mütterlichen Instinkt überlassen. Ein Säuglingsleben nach Plan.
Meine Tochter Jette, stillte ich, wenn sie sich meldete. Wenn Jette schrie, bemühten der Kindsvater und ich uns, herauszufinden, was sie quälte. Mein Vater sagte dazu nur „Lass sie schreien. Das stärkt ihre Lungen“. Alte Erziehungsideale aus dunklen deutschen Zeiten. 1934 verfasst von der Ärztin Johanna Haarer, einer leidenschaftlichen Nationalsozialistin. In ihrem Buch „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ (die letzte Auflage erschien 1987 – unglaublich) werden die Erziehungsgrunsätze der Nazis und ihre Umsetzung beschrieben. Nicht die Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit des Kindes steht im Mittelpunkt der Erziehung, sondern das Heranziehen eines gehorsamen und widerstandslosen Menschen. Kinder, die für Autorität gefügig gemacht sind. Abhärtung statt Liebe. Hitlers Erziehungs- Regime im Jahr 2003 aus dem Mund meines Vaters. Hitlers Erziehungs- Regime als Grundlage für meine eigene Erziehung. Können Menschen, die man als Säugling schreien lässt, um sie abzuhärten und zu stärken, selber lieben?
Wer so auf das Leben vorbereitet wird, setzt sich nicht mit Ausbrechen auseinander. Das Leben als Pflichterfüllung. Auszubrechen aus einer unglücklichen Beziehung war, schon alleine wegen Jette, unvorstellbar. Und so biss ich die Zähne zusammen.