-
Die Geschichte endet nicht mit uns. Sokrates (470 – 399 v. Chr.)
Es sieht so aus, als würde es nicht weitergehen?
Dieser Eindruck stimmt nur teilweise. Ich habe mittlerweile das Buch fertiggestellt, korrigiert und schreibe am Exposé. Parallel dazu laufen erste konzeptionelle Überlegungen zu einem zweiten Roman, der sich wieder mit einer Familiengeschichte unter dem Kontext der deutschen Geschichte befassen wird.
Ich habe mich allerdings gegen eine Veröffentlichung des Romans über das Internet entschieden. Wer dennoch Interesse am weiteren Verlauf der Ereignisse um Henriette und ihrer Enkelin Greta hat, kann mich gerne anschreiben.
-
Angst fressen Seele auf

Ein perfektes Zitat von Fassbender für das Leben mit psychischen Erkrankungen.
Angst vor allem. Angst vor Gemeinschaft, Angst vor anderen Menschen. Angst vor Einsamkeit.
Angst vor einem netten Gespräch mit Bekannten oder Kollegen, die einem nichts Böses wollen und gleichzeitige Angst vor der unerträglichen Stille der Einsamkeit.
Wer, der an psychischen Erkrankungen leidet, kennt das nicht.
Greta leidet seit Jahren an Depressionen und Ängsten. Ein kurzes Gespräch mit Kollegen, eine Einladung von einer Bekannten zum Kaffee, ein Treffen von Nachbarn in der Stadt. Jedesmal übersteht sie diese Situation mit „lockerer Konversation“ nur mit Schweißausbrüchen, Herzrasen und völliger Erschöpfung anschließend. Ist es verwunderlich, dass sie sich vor solchen sozialen Kontakten immer mehr zurückzieht, bis sie völlig isoliert ist. Und darunter gleichermaßen leidet.
Ihre Großmutter Henriette wurde 1901 geboren und erlebte, trotz aller Schwierigkeiten der damaligen Zeit in den ersten Jahren unter dem Kaiser, dem erstem Weltkrieg und der Weimarer Republik, als sich das Volk gegen die junge Demokratie wand, die unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit einer Berliner Familie des Bildungsbürgertums. Durch ihre mehr gestrenge als liebevolle Mutter wird sie auf das Leben in der Gesellschaft vorbereitet. Adrettes Aussehen, niveauvolle Bildung und gesellschaftliche Umgangsformen waren wichtiger als Urvertrauen und Geborgenheit. Äußere Erscheinung wichtiger als innere Werte. Einen Ehemann für die junge Frau zu finden, wichtiger als ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Nicht die Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit zu fördern war wichtig. Viel wichtiger war es, sie auf die Rolle an der Seite eines Ehemanns zu vorbereiten. Eine gute Schulbildung, um den Gesprächen folgen zu können. Häufige Theaterbesuche, um Diskussionen über die Kultur adäquat verfolgen zu können, natürlich ohne sich selbst zu viel einzumischen. Ballet- Unterricht, um ein graziles Auftreten auf den Gesellschaften zu gewährleisten. Klavierunterricht, um dem Ehemann abends eine entspannende Atmosphäre gewährleisten zu können.
Schulbildung – weniger wichtig, schließlich würde der zukünftige Ehemann das Geld verdienen.
Kindererziehung- weniger wichtig, wozu gab es Kindermädchen. Selbstständiges Leben – wozu, die Frau wurde finanziell vom zukünftigen Ehemann versorgt werden.Und Greta, ihre Enkeltochter?
Sie wurde mehr als sechzig Jahre nach ihrer Großmutter geboren.
Mittlerweile waren Emanzipation und Gleichberechtigung die Stichworte der Zeit.
Doch ihre Großmutter und auch ihre Mutter waren verbacken mit der alten Zeit. Eine Frau musste hübsch anzusehen sein, eine adäquate Gesprächspartnerin für ihren Ehemann, auf gesellschaftlichen Anlässen hübsch und gebildet wirken und eine gute Mutter sein.Doch die Zeit hatte sich geändert! Frauen mussten natürlich weiterhin das Frauenbild, das auch mit zunehmender Bedeutung der Medien aufrechterhalten wurde, erfüllen. Sie mussten auch weiterhin die geforderte Mutterrolle erfüllen! Bis 1958 konnte ein Ehemann über das Dienstverhältnis seiner Frau entscheiden – das heißt, es lag bei ihm, ob sie arbeiten durfte und wenn er seine Meinung ändern sollte, konnte er auch jederzeit das Arbeitsverhältnis seiner Frau kündigen. Noch bis 1977 durfte eine Frau in Westdeutschland nur dann berufstätig sein, wenn das „mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar“ war. Aufgaben im Haushalt und in der Kindererziehung blieben klar der Frau zugeordnet und waren vorrangig.
Doch im Laufe der weiteren Jahrzehnte ging die Entwicklung weiter. Im Zuge der Emanzipation wollten und sollten auch die Frauen einen Beruf erlernen, sich weiterbilden und eigenes Geld verdienen.
Und dennoch blieb das Bild der Frau als „Mutter der Familie“ unverändert.
Jetzt hieß es also nicht mehr Mutter und Familie allein, sondern zusätzlich beruflicher Erfolg.
Frauen wurden mit Muli- Tasking- und Omnipotenz- Fähigkeiten belegt, der Mann konnte sich auf seine Kernkompetenzen zurückziehen und machte trotzdem weiter Karriere, während Frauen sowohl auf beruflicher als auch auf privater Ebene scheiterten.
So erging es Greta. In ihrer Jugend vollgestopft mit Terminen wie Ballet- und Klavierunterricht und regelmäßigen Theaterbesuchen mit den Eltern. Sie hatte in ihrer Jugend bereits einen vollen Terminkalender. Doch trotzdem hörte sie von ihrer Großmutter „Sie geht wie ein Trampel“. Ihre Mutter saß hilflos daneben, wollte sowohl ihrer Mutter als auch ihrer Tochter nicht in den Rücken fallen.
Nach Abitur und Studium fand sich Greta in der Situation einer berufstätigen Frau und Mutter wieder. Sowohl beruflich als auch als Ehefrau und Mutter wurden hohe Ansprüche an sie gestellt.
Ist es ein Wunder, dass sie an diesen Ansprüchen und ständigen Vergleichen mit ihrer Großmutter, die das gesellschaftliche Leben so gemeistert hatte und doch sich beruflichen Anforderungen nie stellen musste, scheiterte? Dass sich Versagensängste in ihr alltäglichen Leben einschlichen?
-
Schneckenhaus versus Öffentlichkeit
Ich schreibe für mich. Schreiben als Therapie, Schreiben als Ventil.
Aber natürlich träume auch ich, nachdem ich so viel Zeit und Herzblut in das Projekt gesteckt habe, von einer Veröffentlichung. Genauso, wie ich Angst vor vernichtender Kritik habe. Oder Angst davor, meine meine Familie könnte es lesen und sich gekränkt fühlen. Denn ich liebe meine Familie. Oder aber, dass das Projekt meine berufliche Laufbahn vernichtet. Denn für viele kann eine depressive Ärztin ein Problem bedeuten. Man denke allein an Konzentrationsstörungen infolge der Erkrankung. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ähnlich, wie der depressive Pilot, der im März 2015 den Airbus A320 des Germanwings- Flugs 9525 in den französischen Alpen im Sinne eines erweiterten Massen- Suizid mit Absicht zum Absturz brachte.
Um all dies zu verhindern, schreibe ich unter einem Pseudonym. Das fühlt sich ein bisschen so an, als bekäme ich im Rahmen eines Zeugenschutz- Programmes eine neue Identität.
Aber was soll ich sagen, meine über achtzig- jährige Mutter war die erste, die die Seite entdeckte…
-
Prolog
Deine Krankheit ist ein Feuer. Du bist mitten drin im Feuer. An manchen Tagen schaffst Du es nicht, den Eimer mit Wasser zum Löschen zu erreichen.
Jette im Herbst 2012
—
Hänschen klein ging allein,
in die weite Welt hinein
Stock und Hut steh´n ihm gut,
er ist wohlgemut.Doch die Mutter weinet sehr,
hat ja nun kein Hänschen mehr,
da besinnt sich das Kind,
eilt nach Haus geschwind. -
Wendehammer
Greta 2012
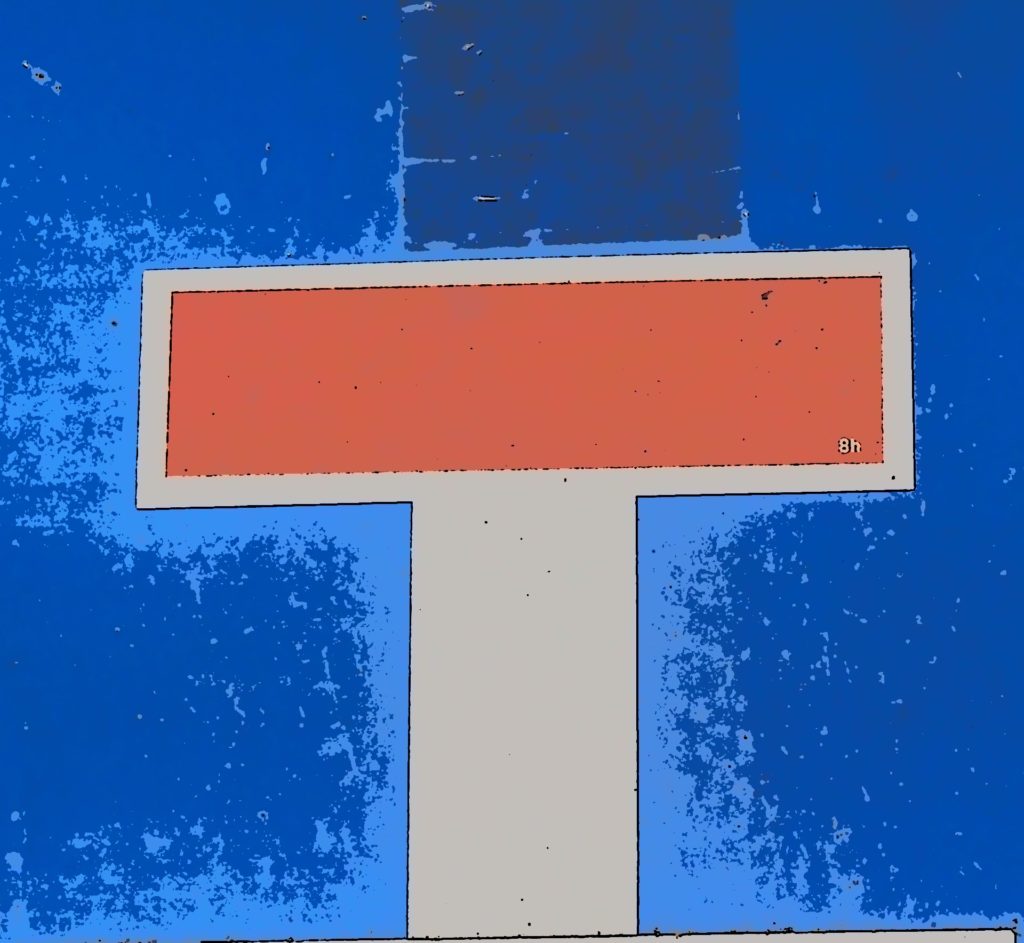
Als meine Tochter 10 Jahre alt war, habe ich sie verlassen. Ich kehrte einen Tag später zurück, aber sie konnte es mir nie mehr verzeihen. Mit 11 Jahren hat sie mich verlassen. Beide Ereignisse habe ich nie verwunden. Ein Messer bohrte sich in meinen Rücken und verursacht seitdem tägliche Schmerzen. Meine Selbstverachtung wuchs von Tag zu Tag und löste mein inneres ICH auf.
Jeder einzelne von uns trägt in sich das Vermächtnis seiner Vorfahren. All ihre erlebten Stunden prägen auch unser Dasein auf dieser Welt, obwohl wir selbst nicht dabei waren. Jede Sekunde, die wir leben, fügen wir dem Bild neue Eindrücke hinzu. Dadurch bekommt es eine andere Färbung, aber das Bild bleibt das Gleiche.
Wir wollen im Hier und Jetzt leben, doch in jedem einzelnen Moment spüren wir unsere Vergangenheit wie einen schweren Rucksack und die Ungewissheit der Zukunft lauert uns auf. Und so zerrinnen die Momente unseres Lebens, wie die Körner in einer Sanduhr hinabrauschen.
Mit meinem 45. Geburtstag stellte ich erstmals fest, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mehr als die Hälfte meines Lebens vorbei war. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Wo bin ich, wo will ich hin? In einer alten Sparkassen- Werbung der 80er Jahre sieht eine Bestandsaufnahme so aus: mein Haus, mein Auto, mein Boot… Bei mir sah es etwas anders aus: Ich hatte eine Tochter (wunderbar), eine Fernbeziehung (Prädikat nicht empfehlenswert), einen Kindsvater (mehr ist von ihm leider nicht übrig geblieben) und einen Ex- Mann (nicht identisch mit dem Kindsvater). Dazu ein Haus, das so klein war, dass es allenfalls für Puppen eine Villa wäre und wenige, die Betonung liegt auf wenige, Bekannte. Freunde – Fehlanzeige.
Im Sommer 2010 hatte ich mich in eine Sackgasse manövriert und der Wendehammer war verdammt eng.
Äußerlich betrachtet war alles perfekt. Mit Sebastian, dem Kindsvater, und unserer Tochter Jette hatte ich eine Familie, wir lebten in dem Puppenhaus und beruflich hatte ich mich gerade selbständig gemacht. Aber für mich stimmte nichts. Mein Beruf fraß mich auf. Ich schaffte es nicht, zu meiner Tochter eine innige und liebevolle Beziehung aufzubauen. Ich war nicht in der Lage, Freundschaften aufzubauen. Schlimmer noch, soziale Kontakte außerhalb meines Berufslebens waren für mich der pure Stress. Ich steckte in einer unglücklichen Beziehung fest. Zig mal schaute ich Sebastian an und fragte mich, was so verdammt falsch an ihm war. Er hatte mich nie im Stich gelassen, war immer für mich da, sah gut aus und war nebenbei auch ein sehr liebevoller Vater meiner Tochter. Wo verdammt war das Problem?
Sebastian und ich hatten uns einfach verloren. Es war keine Absicht. Es gab keinen Streit. Es passierte einfach so. So wie man nach jedem Waschmaschinengang arme, verwaiste Socken vorfindet. Man steckt sie als Paar in die Waschmaschine und beim Sortieren der gewaschenen Wäsche fehlt eine Socke. Immer nur eine. Sie verschwinden nie als Paar. So etwa lief das bei Sebastian und mir. Wir starteten als Paar in den Alltag und ohne es zu merken, verloren wir uns.
Während es ihm gelang, zu unserer Tochter Jette eine innige Beziehung aufzubauen, gelang mir dies nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte zu ihr keine Nähe herstellen. Ich war eine Mutter ohne mütterliche Gefühle.
So befand ich mich in meiner tiefsten Krise. Zumindest dachte ich das damals. Es sollte alles noch viel schlimmer kommen, aber das wußte ich damals noch nicht. Damals hatte ich mich verloren. Weder das Wann und Wo noch das Warum war mir klar. Ich befand ich mich im freien Fall und fiel immer weiter und tiefer. Wie in einem der ekligen Albträume, aus denen man irgendwann schweißgebadet aufwacht. Nur, dass ich nicht mehr aufwachte.
Obwohl ich mein Leben damals unerträglich fand, konnte ich doch nicht ausbrechen. Ich konnte nicht einmal darüber nachdenken, so sehr Angst machten mir solche Gedanken. Jegliche Überlegungen über ein freies und selbstbestimmtes Leben ließ ich einfach nicht zu. Schlimmer noch, ich hatte einfach keinerlei Idee, wie ein freies Leben aussehen könnte.
Während ich das schreibe, sitze ich an einem warmen Herbsttag bei geöffneten Türen am Schreibtisch. Noch wärmende Sonnenstrahlen fluten den Raum und von draußen strömen die Geräusche der Nachbarschaft herein. Irgendwer mäht den Rasen, irgendwo spielen Kinder und lachen. Eine große grüne Libelle, wunderschön glänzend, hat sich nach innen verirrt und zappelt am Fenster entlang. Ich will ihr zeigen, wo es wieder rausgeht. Flieg raus, du schöne Libelle, denke ich. Denn hier drinnen wirst du nur sterben. Draußen bleiben dir noch ein paar schöne Tage des Spätsommers. Aber sie lässt sich nicht beirren. Und irgendwo stirbt in diesem Moment ein Mensch.Ich wurde am Ostermontag 1967 geboren. Es war ein kaltes Osterfest, draußen lag Schnee und ein eisiger Wind wehte über die kleine Stadt hinweg. Für die kommende Nacht war eine Sturmflut vorhergesagt worden. Das alles schien mich hervorzulocken, und so setzten bei meiner Mutter Margarete, genannt Marga, die Wehen ein. Voller Aufregung fuhren meine Eltern sofort ins Krankenhaus. Dort angekommen wurden sie erst einmal auf die Treppe geschickt. „Die Stufen immer schön herunter springen. Ihr Mann soll sie gut festhalten. Immer wieder rauf und runter. Wir müssen etwas Bewegung in die Sache bringen.“ Das waren die Anordnungen des diensthabenden Gynäkologen. Damit begann der erste Teil der Entbindung. Der Part, an dem der werdende Vater Hermann noch teilnehmen durfte. In den Kreißsaal durfte er nicht mit hinein. Es war ein großer, grüngekachelter Raum, in dessen Mitte unter einer großen OP- Lampe ein gynäkologischer Untersuchungsstuhl stand. Die Lampe gab ein kaltes Licht ab. Zu den quälenden Wehen gesellten sich Angst und das Gefühl, völlig allein zu sein. Aber irgendwann schwemmten die Schmerzen der Wehen die Angst einfach weg.
Kaum hatte ich das Licht der Welt erblickt, riß mich Hebamme Agnes an sich, um mich zu waschen, zu vermessen und in ein weißes Leibchen zu hüllen. Erst dann bekam Marga mich kurz zu sehen. Aber nur kurz. Sofort danach verfrachtete man mich in einen gläsernen Säuglingswagen und brachte mich in das Neugeborenen- Zimmer. Dort konnte mich mein Vater hinter einer Glasscheibe aus der Ferne bewundern.
Meine Mutter und ich schliefen im Krankenhaus, wie damals üblich, selbstverständlich getrennt. Zur festgelegten Fütterungszeit brachte mich Hebamme Agnes in meinem Glas- Porsche zu meiner Mutter. Noch nicht an mich gewöhnt, war meine Mutter sehr aufgeregt, wenn ich schreiend ins Zimmer gefahren wurde.
Meine Mutter erinnerte sich in unserem Gespräch, als ich sie zu meiner Geburt befragte, dass sie damals sofort verkrampfte. Sie habe sich von der Verantwortung, mich alleine satt bekommen zu müssen, erdrückt gefühlt. Hebamme Agnes hielt nicht viel vom Stillen. Ihrer Meinung nach würden die Kinder nicht ausreichend satt werden und schrieen viel länger und häufiger als nach der Flasche. Und so würden die Stillkinder mehr Arbeit verursachen, vor allem die Nächte seien viel anstrengender. Genau genommen hasste sie das Stillen. Der Anblick der nackten, prallen Brüste war ihr peinlich. Entsprechend mürrisch legte sie mich an die Brust meiner Mutter, nachdem diese ihr Nachthemd aufgeknüpft hatte.
Auf den Schmerz, den mein Saugen an ihrer Brustwarze auslöste, war meine Mutter nicht vorbereitet. Ein ziehender Schmerz, der durch Mark und Bein ging. Marga verkrampfte noch mehr. Wahrscheinlich bekam ich nicht genug Milch und begann zu weinen. Agnes presste den Kopf wieder an die Brust, die nächste Schmerzwelle rollte an. Dann verlor Agnes die Geduld und beendete den Prozess. „Wir probieren es morgen wieder“.
Aber da auch beim Stillen das Angebot die Nachfrage regelt, wurde ich wohl tatsächlich nie satt. Also ließ sich meine verzweifelte und von Selbstvorwürfen zerstörte Mutter von Agnes überzeugen, dass die Flaschennahrung für mich das Beste sei.Während meine Mutter mir diese Erlebnisse vor wenigen Jahren schilderte, spürte ich, dass sie sich noch immer Versagen vorwarf. Ich konnte sie nicht trösten – soviel Nähe war nicht möglich. Vielleicht habe ich es mit meinen Abnabelungsprozessen und Distanzierungsversuchen so übertrieben, dass sich keine Nähe mehr heraufbeschwören ließ.
Seit meinem 29. Lebensjahr leide ich an der scheußlichen Krankheit namens Depression. Diese unerträgliche bedrückte Stimmung, die ständig vorhanden ist. Ein Eispanzer hatte sich über mich gelegt, gefror mein Herz und ist immer noch nicht getaut. Diese Unfähigkeit zur Freude, gepaart mit einer ewigen innere Unruhe, als würde ich ständig unmittelbar vor einer Operation am eigenen offenen Herzen stehen. Und sollte gerade einmal ein kurzer Moment der Glückseligkeit eintreten, schlägt die Depression gerade in diesem Moment unbarmherzig zu. Eisblumen statt Sonnenblumen. In der Öffentlichkeit muss ich eine Maske der Unbeschwertheit aufsetzen, was mir alle Kraft bis zur völligen Erschöpfung abverlangt. Deshalb mag ich Christo. So wie er den Reichstag verhüllte, muss auch ich mich ständig verhüllen.
Eine Frage, die mich immer wieder quält, dreht sich darum, ob die Depression wirklich erst mit 29 Jahren begonnen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht doch mein ganzes Leben von Angst und Einsamkeit geprägt ist. War ich jemals ein lustiges und frohes Kind? Beim Heraufbeschwören der Erinnerungen, die leider nicht ihre Kraft verlieren, tauchen immer wieder Bilder auf, die mich erschüttern.
Ich komme aus einem wohlbehüteten Elternhaus. Ich war so wohlbehütet, dass ich kaum Raum für meine eigene Entfaltung hatte. Dies wurde mir Jahre später deutlich, als meine Eltern bei uns zu Besuch waren. Jette war anderthalb Jahre alt war. Sie spielte völlig vertieft und zufrieden mit einem kleinen Ball und einem Esslöffel, bis meine ihr Mutter beides aus der Hand nahm und ihr nahe legte, Eierlaufen zu spielen. Jette hatte sofort jegliches Interesse an dem Ball und dem Löffel verloren, ihr schönes Spiel war zerstört und sie begann sich zu langweilen. Auch mir schrieb meine Mutter immer vor, was ich wie zu machen hatte. Wollte ich etwas anderes, war sie gekränkt und reagierte mit Liebesentzug. Bis ich nur noch machte, was sie wollte. Ich malte Bilder, so wie sie es wollte. Ich trug die Klamotten, die sie schön für mich fand, auch wenn ich mich in der Schule dafür schämte. Tat ich es nicht, war sie so gekränkt, dass ich unter ihrer daraus resultierenden Trauer litt. Als meine Tochter im Kindergartenalter war, malten wir gemeinsam ein großes Bild mit einem Baum im Herbst. Ich musste all meine Beherrschung aufbringen, ihr nicht zu verbieten, in den Stamm die Farben Lila und Hellblau mit einzuarbeiten. Heute hängt das Bild über meinem Bett. Als wunderschöne Erinnerung. Und als Mahnung.
Das Zuhause meiner Kindheit war immer still. Ich bin ein Einzelkind. Das sagt wahrscheinlich schon genug aus. Auch wenn wir alle drei zu Hause waren, war es immer still. Ich hörte in meinem Zimmer Märchen- Platten. „Gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.“ Damals gab es noch Langspielplatten. Ich hatte einen kleinen Plattenspieler, den ich aber nie laut aufdrehte. Als wollte ich die Stille nicht zerstören. In Wirklichkeit lauschte ich mit einem Ohr immer nach der Stimmung meiner Mutter. Lauschte, ob sie weinte. Denn das tat sie oft. Am schlimmsten waren die Sonntage. Andere Familien machten Ausflüge. Wir waren zuhause, allein, jeder für sich. Meine Mutter in der Küche, dazu hörte sie sonntags immer klassische Musik. Natürlich auch leise. Mein Vater verbrachte sein Leben in seinem Arbeitszimmer. Ein typischer Workaholic. Er verließ sein Zimmer nur, wenn es hieß „Essen fertig“. Zu welcher Gelegenheit meine Eltern mich gezeugt haben, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich auf seinem Schreibtisch, als sich meine Mutter zufällig in sein Zimmer verirrte, um zu gucken, ob die Gardinen gewaschen werden müssen. Letztens haben wir festgestellt, dass mein Vater keine Märchen kennt. Mich wundert das nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mir jemals vorgelesen hat. Als dieses Thema zwischen uns zur Sprache kam, witzelte ich, dass er mir bestimmt immer aus dem Handelsblatt vorgelesen habe. Anstatt mich zu beschweren, versuchte ich mit einem Witz, die Schuld von ihm zu nehmen.
Ich lauschte nicht nur auf die Stimmung meiner Mutter, sondern ich wartete auch auf Geräusche meines Vaters. Wartete darauf, dass er endlich aus seinem Arbeitszimmer herauskam, um meine Mutter zu trösten. Natürlich tat er es nicht. Also ging ich zu meiner Mutter und versuchte sie, aus der trüben Stimmung herauszuholen.
Szenen dieser Art gibt es in meinem Erinnerungsschatz in Hülle und Fülle.
Und doch ist meine Mutter fürsorglich und liebevoll. Viele kleine Szenen geistern mir im Kopf herum, in denen sie mir nah ist. Ich sehe uns in der Küche stehen, ich als kleines Mädchen, wir schälen Äpfel. Sie kann die Äpfel so schälen, dass die Schale an einem Stück bleibt. Anschließend werfen wir die Schale hinter uns und versuchen zu erkennen, ob sie in einer Buchstabenform auf dem Boden gelandet ist. Dieser Buchstabe wäre der Anfangsbuchstabe des zukünftigen Ehemannes.
Sie bastelte viel mit mir, brachte mir Stricken und Häkeln bei und spielte mit mir Reisebüro oder Post.
Noch vor kurzem hätte ich meine Kindheit sogar als geborgen und behütet bezeichnet. Jahrelang hielt ich meine Mutter für meine beste Freundin und es hat lange gedauert, die traurigen Erinnerungen in Einklang zu bringen mit der Wahrnehmung, dass meine Kindheit behütet war. Das war sie. Wohl nur zu behütet. Und sie war geprägt von der Last, die meine Eltern wiederum mit sich tragen. Aufgebürdet von ihrer eigenen Geschichte.
Meine Eltern sind nicht schuldig an meiner Situation. Jedenfalls nicht im Täter- Sinne.
Meine Eltern Margaret und Hermann feiern in Kürze ihren fünfzigsten Hochzeitstag. Mein Gott, wie schafft man das? Wohl, indem man nicht ausbricht. Statt dessen ordnete sich meine Mutter ihrem Mann unter. Sie war nach dem Abitur 1956 auf dem Lette- Haus in Berlin. Offiziell nannte sich das Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiterin. Dort lernte sie, wie man einen Mann mit Anmut bekocht und versorgt. In der ARD- Serie „Die Bräuteschule“ habe ich im Vorspann Bilder von meiner Mutter im Lette Hause gesehen. Dort wurde auch die Säuglingspflege erlernte. Das, was sie im Lette- Haus erlernte, wandte sie bei mir an. Gefüttert wurde zu festen Zeiten. Alle vier Stunden. Ob ich Hunger hatte oder nicht. Schlief ich, wurde ich zum Füttern geweckt. Dafür zog Marga sich einen weißen, reinen Kittel an und gab mir die Flasche. Täglich wurde ich gewogen – die Waage steht noch heute in unserer Küche. Jeden Abend wurde ich gebadet. Nichts wurde dem mütterlichen Instinkt überlassen. Ein Säuglingsleben nach Plan.
Meine Tochter Jette, stillte ich, wenn sie sich meldete. Wenn Jette schrie, bemühten der Kindsvater und ich uns, herauszufinden, was sie quälte. Mein Vater sagte dazu nur „Lass sie schreien. Das stärkt ihre Lungen“. Alte Erziehungsideale aus dunklen deutschen Zeiten. 1934 verfasst von der Ärztin Johanna Haarer, einer leidenschaftlichen Nationalsozialistin. In ihrem Buch „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ (die letzte Auflage erschien 1987 – unglaublich) werden die Erziehungsgrunsätze der Nazis und ihre Umsetzung beschrieben. Nicht die Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit des Kindes steht im Mittelpunkt der Erziehung, sondern das Heranziehen eines gehorsamen und widerstandslosen Menschen. Kinder, die für Autorität gefügig gemacht sind. Abhärtung statt Liebe. Hitlers Erziehungs- Regime im Jahr 2003 aus dem Mund meines Vaters. Hitlers Erziehungs- Regime als Grundlage für meine eigene Erziehung. Können Menschen, die man als Säugling schreien lässt, um sie abzuhärten und zu stärken, selber lieben?
Wer so auf das Leben vorbereitet wird, setzt sich nicht mit Ausbrechen auseinander. Das Leben als Pflichterfüllung. Auszubrechen aus einer unglücklichen Beziehung war, schon alleine wegen Jette, unvorstellbar. Und so biss ich die Zähne zusammen. -
Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Greta 1997 – 1998

Wie schon erwähnt habe ich auch einen Ex- Mann. Meine gescheiterte Beziehung mit Sebastian ist also nicht die erste. Bereits ein Makel. Ein Zeichen meiner Unfähigkeit, Beziehungen einzugehen und zu halten.
Am 4.7.1997, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, heiratete ich meinen Kommilitonen Phillip. Das Fest selbst war wunderschön, obwohl ich bereits damals spürte, dass etwas nicht stimmte. Besonders während der kirchlichen Trauung. Ich weinte und hatte gar keine Chance, die Tränen zurückzuhalten.
Ich trug ein schlichtes, champagnerfarbenes Kleid, das mir eigentlich gut gefiel. Aber eben nur eigentlich, denn man hatte dieses schlichte Kleid mit allerlei Accessoires ausstaffiert, die weder zu diesem Kleid noch zu mir passten. Ich hatte es mit mir geschehen lassen. Hatte mich nicht gegen die Vorstellungen der anderen aufgelehnt.
Eigentlich hatte ich mein Brautkleid in einem kleinen, hübschen Geschäft in der Stadt kaufen wollen. Hätte ich eine Freundin gehabt, so hätte ich es gerne mit ihr zusammen gemacht. In meiner Vorstellung wurde uns dazu ein Glas Sekt gereicht und in aller Ruhe suchten wir so lange aus, bis ich schließlich MEIN Kleid gefunden hatte. Aber natürlich hatte ich keine Freundin. Und genauso natürlich hatte ich meine Mutter, die selbstverständlich dabei sein wollte. Die Vorstellung, mit meiner Mutter ein Kleid auszusuchen, hatte etwas Beängstigendes für mich. Aber noch viel beängstigender war die Vorstellung, meiner Mutter zu sagen, dass ich sie nicht dabei haben wollte. Um die Spannung zwischen ihr und mir zu reduzieren, nahmen wir auch meinen Vater und Phillip mit. Eigentlich heisst es ja, der Bräutigam solle das Kleid vor der Trauung nicht sehen – wir hielten es nicht so streng. Und es wird wohl auch nicht der Grund für das Scheitern unserer Ehe gewesen sein.
Mein Vater kannte als ehemaliger Landwirtschaftslehrer ein großes Geschäft für Brautmoden auf dem Lande. „Brautmode für Bauerntrampel“, dachte ich damals, als ich die vielen großen Ständer mit üppigen Kleidern für üppige Frauen mit üppigen Busen sah. Aber immerhin, ich fand ein schmal geschnittenes, Kleid und damit hätte alles gut werden können. Doch die Verkäuferin und meine Familie fanden, dass ich damit nicht genug nach einer Braut aussah. Statt eleganter Handschuhe (warum nur hatte ich dies nicht vorgeschlagen?), wurde mir ein Spitzenjäckchen übergestreift. Schließlich mussten ja in der Kirche die Schultern verhüllt werden. Dazu wurde mir noch ein Schleier auf den Kopf gesetzt. Am Hochzeitstag selbst kam dann noch ein verspielter Brautstrauß dazu. Kein Strauß, den ich mir erträumt hatte. Ein Strauß, der keine von meinen Lieblingsblumen enthielt. Aber ich wollte Phillip nicht kränken. So, wie ich niemanden kränken wollte. Und so ließ ich mich ausstaffieren.
Dafür fühlte ich mich am meinem großen Tag, der der schönste meines Lebens sein sollte, nicht wie ich selbst. Eine kitschige Barbie- Puppe trat vor den Altar, um von einer Abhängigkeit in die nächste zu treten. Phillip würde das fortsetzen, was meine Eltern bislang getan hatten. Hatte ich das damals schon gewusst? War diese Erkenntnis der Grund für meine Tränen in der Kirche?
Auch Phillips Hochzeitsanzug suchten wir alle vier gemeinsam aus. Als Phillip im Anzug vor dem Spiegel stand, war mein Vater begeistert. „Ganz der Herr Professor“. Phillip musste ihn erinnern: „Nicht ich befinde mich in der Laufbahn zur Habilitation, sondern Deine Tochter.“ Danke Philipp. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater Stolz auf mich zeigte. Oder ich war dafür nicht empfänglich.
Die Ringe, die wir tauschten, gefielen mir damals nicht. Es waren Erbstücke. Alte gebrauchte Eheringe, die in meiner Familien zu diesem Zweck schon einmal genutzt worden waren. Keine neuen, gemeinsam ausgesuchten Ringe. Damals habe ich sie gehasst. Heute, wo ich die Geschichte meiner Familie kenne, denke ich anders über die Ringe. Heute würde ich meinen Ring vielleicht mit Stolz und Würde tragen, aber heute gibt es diese Ehe nicht mehr.
Mein Ring war vormals der Ehering meiner Urgroßmutter Charlotte. Den dazugehörigen ihres Mannes Ernst gab es nicht mehr. Er war während der Flucht im Krieg verloren gegangen. So kam es, dass Phillip den Ring meines damals schon verstorbenen Großvaters Alexander bekam. Von dem Mann, der das Leben so liebte und der in seiner Ehe so unglücklich gewesen war. Natürlich gab meine Großmutter Henriette den Ring ihres verstorbenen Gatten nicht gerne her. Aber meine Mutter hatte sie wohl lange genug bekniet.
Keinen Erfolg hatte sie bezüglich Henriettes Ring. Meine Großmutter wollte diesen bis zu ihrem eigenen Tod in Gedanken an ihren wundervollen Mann und ihre wunderbare Ehe selber tragen. Auch wenn jene Ehe eben nicht wunderbar war, beneidete ich sie, dass sie ihre Erinnerungen so verklären konnte.
So kam es, dass Philipp und ich abgelegte Ringe aus verschiedenen Ehen bekamen. Aber auch dies wird nicht der Grund für das Scheitern unserer eigenen Beziehung gewesen sein. Wäre es ein Ringpaar aus einer alten glücklichen Ehe gewesen, hätte ich es damals vielleicht leichter gehabt. Ein Ringpaar mit viel Tradition und schönen Geschichten aus einer glücklichen Ehe.
Die Ringe sahen sich noch nicht einmal ähnlich. Es war auf Anhieb zu sehen, dass sie nicht zusammen gehörten. Okay, sie waren beide aus Gold, aber das war auch schon alles an Gemeinsamkeiten. Phillips Ring war breit und kantig, meiner schmal und abgerundet.
So erlebte ich den Akt der Trauung als Darstellerin in einem Film. Das war nicht ich, die das Ja- Wort sprach. Nein, deutlicher: Es war eine Greta, die niemals eine Kontrolle über sich selbst erzielt hatte.
Die Ehe hielt kein ganzes Jahr. Noch vor unserem ersten Hochzeitstag waren wir getrennt.
Während dieses knappen Jahres wurde meine Depression immer schlimmer. Es eskalierte durch Arbeitsüberlastung und Kälte in unserer Beziehung. Mein Beruf als Ärztin und gleichzeitige Forschung an der Uni überforderten mich zusehends. Niemals werde ich das Gespräch mit meinem Professor vergessen, in dem ich ihn bat, mich von der Forschungsarbeit freizustellen. Aber auch dieser Versuch der Notbremse, alles mit Arbeitsüberlastung zu erklären und eine Besserung nach einer Arbeitsreduktion zu erwarten, fruchtete nicht. Zwei Wochen später war ich komplett arbeitsunfähig. Eine junge Frau, frisch verheiratet und gerade in eine Traumwohnung gezogen, lag nur noch vor Angst apathisch und gelähmt im Bett und verließ es Tag und Nacht nicht mehr. Und Phillip? Der frisch gebackene Ehemann versuchte so zu tun, als sei alles in Ordnung und ergriff die Flucht, wo es nur ging. An dem ersten schlimmen Wochenende nach meiner Krank- Schreibung fuhr er mit gemeinsamen Freunden zum Wandern in die Schweiz. Ich quälte mich allein zuhause im Bett. Auch das werde ich nie vergessen und ich konnte es Phillip nie verzeihen. Es war der eigentliche Akt unserer Trennung, die kurz danach vollzogen wurde.
Nahtlos ging ich die Beziehung mit Sebastian ein. Wir kannten uns aus dem Krankenhaus, er war da, ich wollte nicht allein sein und so wurden wir ein Paar. Philipp zog aus, Sebastian zog ein. Ein chancenloser Akt.
Nahtlos ging ich die Beziehung mit Sebastian eingegangen. Wir kannten uns aus dem Krankenhaus, er war da, ich wollte nicht allein sein und so wurden wir ein Paar. Philipp zog aus, Sebastian zog ein. Ein chancenloser Akt.
Weihnachten 2012 würde meine Mutter, nachdem meine Eltern Lebenspartner Nummer Drei kennenlernten, sagen: „Wir sammeln Schwiegersöhne“. Natürlich kränkte mich dieser Satz. Aber heute kann ich es anders betrachten. Sie hatten eben auch ihre Schwierigkeiten, mein unperfektes Leben in der perfekten Umgebung einer Kleinstadt vor sich und den perfekten Bekannten zu verteidigen.
-
Ent- Bindung
Greta 2003

Jette wurde im März 2003 geboren. Morgens war ich noch in der Stadt und wunderte mich, dass mir der kleinste Weg so schwer fiel. Wieder zuhause, setzten gegen zwölf Uhr die Wehen ein. Es dauerte ein bisschen, bis ich begriff, dass es nun endlich los ging. Jette trat ihre Reise in unsere Welt an. Ich machte mir den Kamin an und wehte vor mich hin. Wie durch ein Wunder kam Sebastian früher nach Hause, er hatte wohl das richtige Gefühl. Wir duschten noch und fuhren gegen 19 Uhr in die Klinik los. Dort angekommen, hatten Jette und ich schon gute Arbeit geleistet und alles sah gut aus. Im Kreissaal war ich froh, dass Sebastian bei mir war und mir die Angst nahm. Nach dem anfänglich gutem Verlauf, stellte sich plötzlich der totale Stillstand ein. Nach 16 Stunden und mit der Zeit immer schmerzhafteren Wehen, ging es dann plötzlich schnell. Es wurde ein Kaiserschnitt erforderlich. Die Peridualanästhesie war so gut, dass ich alles miterleben konnte. Trotz all der Ängste, war ich froh, es bei Bewusstsein miterleben zu können. Gleich würde ich meine Tochter sehen. Sah ich nicht. Das Kind wurde, kaum dass man es aus meinem Bauch geborgen hatte, dem Kinderarzt übergeben. Der schrie nur noch „Wir fahren los. In die Kinderklinik auf Intensiv.“ Diese Sätze habe ich erst im Nachhinein begriffen. Die Gynäkologen nähten meinen Bauch wieder zu und ich wurde auf mein Zimmer gebracht. Auch in diesem Moment habe ich noch nicht alles begriffen. Sebastian hielt meine Hand und küsste mich auf die Stirn. Dann fuhr er. Und erst dann begriff ich, dass ich auf der Wochenstation allein lag.
Es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass der erste Kontakt zwischen Mutter und Kind unmittelbar nach der Geburt immens wichtig ist. Das Kind wird der Mutter auf den Bauch oder an die Brust gelegt und damit der Grundstein für die gesamte folgende Beziehung zwischen Mutter und Kind gesetzt. Bei mir lag kein Kind. Auf mir lag kein Kind. An meiner Brust lag kein Kind. Ich hatte meine Tochter noch nicht einmal gesehen. Ich lag in einem weißen Krankenhauszimmer, allein, verkabelt mit allerlei Schläuchen, müde und erschöpft.
Am folgenden Vormittag kam mich mein Chef besuchen. Er brachte einen großen Blumenstrauß und machte nette Worte. Dass kein Kind da war, bemerkte er gar nicht. Es war eine völlig surrealistische Situation.
Am Nachmittag besuchte Sebastian unsere Tochter Jette auf der Intensivstation. Er brachte gute Nachrichten mit, es ginge ihr gut.Zwei Tage nach der Entbindung wurde Jette in die Frauenklinik, in der ich lag, überführt. Die Augenblicke davor waren schrecklich. Wir saßen im Säuglingszimmer, zusammen mit anderen sich dort aufhaltenden Eltern, schreienden und schlafenden Säuglingen und Krankenschwestern. Ich war aufgeregt und ängstlich. Vor meiner eigenen Tochter. Ich überlegte, ob ich sie als solche erkennen und erspüren würde, oder ob man mir auch einen wildfremden Säugling bringen könnte. Man legte mir das Kind in die Arme, dass ich neun Monate unter meinem Herzen getragen hatte und das mir doch fremd war.
Jette war auf der Intensivstation mit der Flasche gefüttert worden, bis sie sich an mich und meine Brust gewöhnte, war es ein hartes Stück Arbeit.
Jette und ich hatten eine gemeinsame Zeit verloren, der wir lange hinterher rennen mussten. Mittlerweile weiß ich, dass wir sie nie richtig aufgeholt haben.
Jette verdankt ihren Namen nicht nur ihrer Ur- Großmutter als Abwandlung von deren Namens Henriette, sondern auch dem Buch „Wir, die das Leben lieben“ von Karen Aabye. Eigentlich ein Kitsch- Buch, welches im Dänemark des 19. Jahrhunderts spielt. Für mich ein Buch mit Herzenswärme und mit einer wundervollen Message: Das Leben ist liebenswert. Nicht, dass ich diese Botschaft besonders gut umgesetzt bekomme, aber sie hat mich so beeindruckt, dass sie mich dazu veranlasst hat, meine Tochter Jette zu nennen.
Das Buch endet mit einer Rede der Protagonistin für ihre Tochter Jette an deren Hochzeitstag:
„Liebe kleine Jette! Würde Dein Vater noch leben, dann würdest Du heute von ihm all die gutgemeinten Worte hören, die Eltern an solch einem Tag nun einmal auf dem Herzen haben. Aber das Schicksal hat es anders gewollt.
Ich erinnere mich noch daran, Jette, als Du zu mir kamst und mich fragtest, ob es eine Sünde sei, wenn man froh ist. Du warst fünfzehn Jahre alt (…).
Ich weiß auch noch, dass ich lachte und dass Du mich etwas vorwurfsvoll ansahst. Aber dann antwortete ich Dir in vollem Ernst. Die Freude am Leben ist das Schönste, was die Menschen mitbekommen haben. Die Freude an den kleinen Dingen. Die Freude über einen Menschen, der sich einem anvertrauen will, die Freude über die schwankenden Zweige einer Birke, die Freude über das gute Gedeihen des Viehs und der Äcker und die Freude, einen Menschen wiederzusehen, den man vermisst hat.
Es kann übermütig, eingebildet klingen, Jette, aber jedes mal, wenn mich das Leben fast umgeworfen hat, hat mir eine innere Stimme zugeflüstert, dass eine Freude auf mich wartet.
Kleine Jette, Du bist eigentlich gar nicht mehr klein, sondern sehr groß und selbstständig. Für mich bleibst du doch immer die kleine Jette. Von heute an wirst Du nun an Joachims Seite leben.
Keinem wird die Sorge erspart, aber denkt daran, immer, und ich sage Euch – immer liegt etwas Freudiges vor Euch und wartet auf Euch.
Das Leben ist eine kostbare Gabe. Uns hat das Leben nie erschrecken können. Wir haben uns ihm entgegengestreckt: lebenshungrig und -jubelnd. Und das haben wir getan, weil wir uns dem Leben verschworen haben. Wir fühlten keine Angst, weil wir einmal geduckt wurden. Wir haben ein Recht auf die Sonne, auf den Regen, auf die Fruchtbarkeit im Wald und auf dem Feld, auf den Sturm im Oktober, auf den Schnee, die Kälte, die Wärme- denn wir haben alles mit Schmerzen bezahlt. (…)
Und solltet Ihr Stürme und harte Zeiten erleben, dann denk daran, Jettekind, dass Du einer Familie angehörst, die das Leben liebt.“
Eigentlich verrückt, so stock- depressiv wie ich bin, liebe ich diese Sätze.
-
In aller Liebe
Greta 2003 – 2005

Es waren seltsame Zeiten, damals nach Jettes Geburt. Eine reine Achterbahn der Gefühle.
Ich war in der Elternzeit, die ich ursprünglich viel kürzer begehen wollte. Aber die Vorstellung, mein Kind einer fremden Frau anzuvertrauen, war mir so unheimlich, dass ich die Zeit verlängerte.
Es war ein ungewöhnlich heißer Sommer, die Sonne schien von April bis Ende September ohne Unterlass. Damals war das noch ein freudiges Ereignis nach vielen schlechten Sommern; das Wort Klimawandel war noch nicht in die Köpfe der Menschen vorgedrungen.
Jette und ich verbrachten fast die ganze Zeit mehr oder minder nackt unter dem schattenspendenden Kirschbaum im Garten auf einer Decke. Ich war so unendlich stolz auf meine kleine süße Tochter, machte wie besessen Fotos, die ich zu hübschen Fotobüchern arrangierte. Wir saßen zusammen im Planschbecken, schmusten in der Dämmerung und entdeckten so wahnsinnig interessante Dinge wie Ameisen im Gras oder Bienen an den Blüten.
Während sie schlief, strich ich unsere Küche neu, recherchierte über die Möglichkeit eines Sabbaticals, das ich mit meiner kleinen Familie unter einfachsten Bedingungen auf einer Alm in den Alpen verbringen wollte, nähte oder strickte Kinderkleider oder suchte im Netz nach angesagten Möbeln und anderen Dingen, die man für ein Leben mit Kleinkind braucht.
Ich fühlte mich seit langem einmal wieder frei, obwohl ich natürlich an ihrer Seite zu Hause blieb. Aber der soziale Rückzug war noch nie mein Problem.
Ich habe wirklich wunderschöne Erinnerungen an diese Zeit, und während ich das jetzt schreibe – übrigens wieder ein äußerst heißer Sommer, diesmal dem Klimawandel geschuldet – laufen mir die Tränen über die Wangen und ich schmecke das Salz auf den Lippen. Immer wieder brauche ich kurze Pausen. Mein Herz so schwer!
Trotz der Leichtigkeit des Sommers litt ich unter einer ständigen Anspannung. Wie hieß es schon einmal so schön: „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“, ein Roman von Milan Kundera. Zu schade, dass dieser wunderbare Titel schon vergeben ist. Darüber ärgerte er sich selbst übrigens in einem seiner späteren Romane.
Jette war eine schlechte Schläferin und vor allem in den ersten Monaten ein echtes Schreikind, was sogar Sebastian belastete. Im Gegensatz zu ihm lastete ich mir die Probleme unserer Tochter an und machte mir Vorwürfe. Risse im Mutterglück, die drohten, mein kleines glückliches Haus im Inneren zu sprengen.
Natürlich gab es auch andere Familien mit Schreikindern, die in der Öffentlichkeit stolz erzählten, auf welche Ideen sie gekommen seien, um das Kind zu beruhigen. Nächtliche, kilometerlange Autofahrten, immer wieder im Kreis um den Block, Staubsaugen oder den Fön anschalten. Mit solchen Geschichten hatte man sogar die Lacher auf seiner Seite. Aber so tickte ich eben nicht.
Ich habe eine Szene im Kopf, von der ich nicht einmal weiß, ob sie sich wirklich so ereignet hat. Jette steht in ihrem kleinen Kinderbett und schreit. Dazu stampft sie mit ihren kleinen Beinchen auf. Tränen laufen über ihr Gesicht. Sie schreit nach mir, die unweit von ihr auf dem Boden sitzt und nicht reagiert. Ich halte die Arme über den Kopf verschränkt und versuche meine Ohren vor den Schreien zu verschließen.
Eine Szene, die für mich bezeichnend ist. Ich liebe meine Tochter, fühle mich aber unfähig, Nähe zu ihr aufzubauen. Genauso, wie ich unfähig bin, Bindungen aufrecht halten. Ich habe weder Vertrauen zu mir noch zu anderen.
Wie kann ich selbst Ur- Vertrauen weitergeben, wenn ich selbst keines habe. Wann gibt ein kleines Mädchen auf, verstummt und gräbt den Kummer in sich ein?
Vor der müden und quengeligen Jette hatte ich Angst. Sie überforderte mich. Sie forderte all meine Aufmerksamkeit, bis ich das Gefühl hatte, sie nahm mir meine eigene Identität.
Auch für meine Eltern wurde ich immer unwichtiger. Sie erkundigten sich nicht mehr nach mir – es ging nur noch um Jette.
Hinzu kam, dass ich mich immer mehr von Sebastian distanzierte. Schon allein aus Eifersucht und Neid, dass ihm der Umgang mit Jette so spielerisch gelang. Er brachte sie zum Lachen, eine Fähigkeit, die ich mir völlig absprach. Und dass ein Säugling eine (sexuelle) Beziehung zwischen Partner belastet, ist wohl allgemein bekannt.
Meine Mutter muss diesen Konflikt, den vermutlich viele Mütter durchmachen, gelöst haben, indem sie all ihre Wünsche und Ziele auf mich projizierte. Nicht mehr sie musste perfekt sein oder im Rampenlicht stehen, sondern ich. Ich wurde benäht und ausstaffiert wie ein Püppchen (alle Kleider, die ich Jette jemals genäht habe, riss sie sich unverzüglich vom Leibe), ich wurde beim Ballettunterricht angemeldet und erhielt einen Klavierlehrer. Maßnahmen, die meine Großmutter Henriette voll unterstützte. Möglicherweise trieb sie meine Mutter sogar dazu an. Schließich hatte meine Großmutter eine Kindheit in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts im mondänen Berlin erlebt, als es wichtig war, eine reizende junge Frau für die Gesellschaft zu erziehen. Ich hatte in meiner Kindheit und Schulzeit mehr tägliche Termine als es heute der Fall ist. Und natürlich wurde auch verlangt, dass ich eine gute Schülerin war. Heute kann ich mir allerdings sehr gut vorstellen, wie unangenehm es für meine Mutter gewesen sein muss, in der einzigen Metzgerei unserer Kleinstadt einkaufen gehen zu müssen. Die Tochter, Cordula Stielike, war die Klassenbeste und saß in der Schule nehmen mir. Sie roch immer nach frischen Wurstwaren, was regelmäßig Übelkeit bei mir erzeugte. Heimlich suchte ich immer ihren Polyester- Pulli nach Resten von Fleisch oder Schweineblut ab.
Die erste Frage, die meiner Mutter entgegen gefeuert wurde, wenn sie die Fleischerei betrat, lautete: „Na, was hat denn Greta in der Klassenarbeit geschrieben?“ Dabei hatte die alte Striehlke bestimmt schon längst gewusst, dass Cordula einmal wieder die beste Note geschrieben hatte.
Der alte Strielke war einmal beim Zerlegen eines aufgehängten Schweins mit dem Messer abgerutscht und hat es sich in den Bauch gerammt. Auf diese Weise hätte er sich fast selbst zerlegt.Als Jette 2 Jahre alt war, begann ich wieder zu arbeiten. Auch wenn mir dadurch ein Stück meiner eigenen Identität zurückgegeben wurde, so gingen mir der ewige Zeitdruck und die Doppelbelastung unablässig an die Substanz. Sowohl im Beruf als auch in der Mutterrolle hatte ich das Gefühl, nicht zu genügen. Meine Versagensgefühle wuchsen zu unbezwingbaren Bergen, vor denen ich noch heute stehe.
-
Außer Kontrolle
Greta im Sommer 2010

Anfang 2008 machte ich mich selbständig. Bis die Praxis so lief, wie ich es wollte, musste ich viel Zeit und Energie aufwenden. Lange, ermüdende Arbeitstage. Ich verließ als erste das Haus und kam erst spät abends nach Hause, wenn Sebastian Jette schon ins Bett gebracht hatte. Ich konnte meiner süßen kleinen Tochter nur noch im Schlaf über das Haar streicheln und atmete begierig ihren Duft nach warmen Schlaf ein. Denn eines war sicher: ich vermisste meine Tochter!
Am Wochenende musste ich mir oft Arbeit mit nach Hause nehmen, weil ich es sonst nicht geschafft hätte, all die Befunde und Briefe zu schreiben. Also verbrachten Sebastian und Jette die meiste Zeit des Wochenendes allein zusammen. Ohne mich. Gingen im Wald spielen, paddelten auf dem See. Fuhren gemeinsam in den Tierpark. Ich fühlte mich immer mehr ausgeschlossen.
Im Sommer 2010 begann ich, nach der Arbeit nicht mehr heimzufahren.
Statt nach einem langen und für mich harten Arbeitstag nach Hause in den Schoß meiner Familie zu fahren, hatte ich mir angewöhnt, an den See zu fahren. Ich hatte Angst, von der einen (beruflichen) in die andere (familiäre) Überforderung zu stürzen. Ich fühlte mich ausgelaugt und der Aufgabe, sofort in die Rolle der liebenden, fürsorglichen und fröhlichen Mutter und Ehefrau zu schlüpfen, nicht gewachsen. Ich fand einfach nicht den Schalter. Statt mich zu Hause geborgen zu fühlen und aufzutanken, empfand ich meine Stellung zu Hause nur als Fortsetzung der Ansprüche, die an mich gestellt wurden. Gleichzeitig machte das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, mich so traurig, dass ich es nicht mehr aushalten konnte.
Schon mein ganzes Leben begleitet mich meine Liebe zum Wasser. Hallen- und Freibäder kann ich nicht ausstehen, aber jedes Naturgewässer zieht mich magisch an. Als Kinder radelten wir im Schwimmanzug mit dem Handtuch auf dem Gepäckträger barfuß zum Fluss, der sogar Sandstrand hat, um dort die Nachmittage zu verbringen. Die Sommerferien verbrachten meine Eltern mit mir an der Nordsee, meist auf einer der vor der Küste gelegenen Inseln. Auch wenn in Mitteldeutschland das Meer fern ist, sodass Meerweh zu meinem ständigen Begleiter wurde, gibt es zum Glück etliche Seen. Ein Handtuch oder eine Decke hatte ich nie mit. Es war die Spontanität, die es für ich so herrlich mache. Dazu die Freiheitsgefühle, die ich schon immer im Wasser verspürt hatte. Das herrlich kalte und gleichzeitig weiche Wasser umgibt den Körper wie Streicheleinheiten. Man verliert für kurze Zeit den Boden unter den Füßen und gewinnt Abstand zum Festland und damit zum Alltag.
Dummerweise hatte ich mir angewöhnt, dabei zu trinken. Ich begann, den Schmerz und die Unzufriedenheit am See wegzutrinken. Nur nichts mehr spüren.
An einem dieser Abende erwischten mich vier freundliche Polizisten und nahmen mich in ihrem Wagen mit aufs Revier. Mein Auto blieb am See.
Ich hatte 1,8 Promille und war den Führerschein erst einmal los. Nachdem ich abgelehnt hatte, mich von den Bullen vom Revier nach Hause fahren zu lassen, trank ich in einer Kneipe noch ein Bier (hatte ich nicht eigentlich schon genug intus?) und bestellte mir ein Taxi.
Und so sah erst einmal meine Zukunft aus: Taxi fahren. Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld ich den freundlichen gelben Autos insgesamt habe zukommen lassen. Aber in all der Zeit kam es nicht einmal vor, dass ich aus der Tür trat und sofort ein Taxi vorbeifuhr, dass ich hätte anhalten können. So etwas gibt es nur im Film.
Ich machte schließlich aus der Not eine Tugend und fing an zu laufen. Seitdem genieße ich die Einsamkeit der Langstreckenläuferin. Dazu laute und harte Musik auf die Ohren. Das Laufen wurde für mich zu meinen Ablassbriefen, um mich von meinen vorangegangenen Sünden zu befreien. Ich nahm 20 kg Gewicht ab. Denn leider hatte das viele Frust- Saufen seine Spuren hinterlassen und meinen Körper nicht schöner geformt. Eine richtige Bier- Wampe war da entstanden. Noch bedauerlicher war, dass mein Figur- Anspruch an mich, nicht in all dem Bier ersoffen war. Und auch die vielen Zigaretten zum Bier hatten mich nicht schöner gemacht. Schon immer habe ich es bedauert, dass es keine Zigaretten gibt, die schlank und schön machen, die Falten verschwinden lassen und so gesund sind wie Vitamine. Das sollte mal erforscht werden. Stattdessen wollen die den Mars erkunden. Wen interessiert der Mars? Ich komme noch nicht einmal in meiner eigenen Welt zurecht.
Aber durch das Laufen war ich wieder recht nett anzusehen und gut trainiert. Allerdings werde ich in Kürze durch die laute Musik beim Laufen ein Hörgerät brauchen.
Unser Nachbar beobachtete meine Lauferei pikiert und unverständlich. Er konnte die Motivation dafür gar nicht verstehen. Als Metzger hat er eine verblüffende Ähnlichkeit mit seinen schweinischen Opfer. Er schlachtete auch zu Hause. Das Quicken der Schweine beim Todesschuss war unerträglich. Jette war immer ganz fasziniert. Ich nicht. Besonders eklig war es, wenn er die Borsten der Schweine abflammte und der Geruch zu uns herüber zog. Naja, leben und leben lassen.Und so laufe ich bis heute. Nur im Winter fällt es mit schwer. Ich mag den Winter nicht. Ich kann Eis, Schnee und Schneematsch nicht ausstehen. Aber das Schlimmste ist die ewige Dunkelheit. Man verlässt am Morgen im Dunkeln das Haus und kommt im Dunkeln wieder. Ich kann jeden einzelnen Isländer verstehen, der wegen der ewigen Dunkelheit säuft wie ein Loch. Vermutlich stehen deshalb in isländischen Telefonbüchern nur die Vornamen der Menschen. Wegen der ständigen Sauferei kann sich bestimmt kein Mensch die schwierigen Nachnamen merken.
Man kann den Sorgen nicht davon laufen, auch nicht, wenn man zwanzig Kilometer oder mehr läuft. Das mag sein. Aber man bekommt Abstand zu den Sorgen. Und dieser Abstand verschafft oft eine andere Blick- und Herangehensweise. Nicht umsonst ist einer der wichtigsten Grundsätze des Buddhismus „drop the thought“. Lass den Gedanken los.
Wahrscheinlich hat Joschka Fischer Recht. Man läuft zu sich selbst und kann sich wieder finden.
Und schließlich sind da ja noch die Endorphine, die glücklich machen.Im Spätsommer besuchte ich meine Eltern. Natürlich mit der Bahn. Die Landschaft flog an mir vorbei, ich starrte trübsinnig aus dem Fenster und hatte das Gefühl, mein Leben flog an mir vorbei. Nichts war greifbar, nichts gehörte zu mir.
Meine Eltern holten mich vom Bahnhof ab. Überflüssig zu sagen, wie unangenehm und peinlich mir die ganze Situation vor ihnen war. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich hatte die ganze Geschichte schon vorher am Telefon gebeichtet, aber so von Angesicht zu Angesicht war es doch noch viel unangenehmer. Erfreulicherweise machten sie nicht viel Aufhebens darum. Wir sprachen auch nicht viel über die Gründe, sie fragten nicht nach, machten sich aber bestimmt ihre Gedanken. Sie ließen mir Zeit, wofür ich ihnen sehr dankbar war. Oder sie hatten Angst vor meinen Antworten auf ihre Fragen und stellten sie daher lieber nicht. Stattdessen versuchten wir, gefährliches Terrain zu vermeiden, machten Touren durch norddeutsche (Hanse-) Städte mit einer netten Mischung aus Kunst und Shopping, tranken Kaffee in den Straßen- Cafés oder gingen abends ins Restaurant mit Blick auf den Fluss.
Eines Nachmittags war ich alleine im Haus. Ich saß in meinem alten Kinderzimmer, ließ die Erinnerungen hochkommen und die Atmosphäre auf mich einwirken. Hier hatte ich meine Platten gehört, Bilder gemalt, Hausaufgaben gemacht und als Teenager meine Träume gehabt. Damals lag das Leben voller Möglichkeiten vor mir. Gerade hatte ich das Gefühl, dass kein Weg mehr vor mir lag, geschweige denn verschiedene. Ich streifte durch die anderen Zimmer, und versuchte die alten Stimmen der Kindheit wieder zu hören.
Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas trieb mich auf den Dachboden. Vorsichtig erklomm ich die enge und wacklige Holztreppe nach oben. Dort war es stickig und warm. Die Deckenlampe machte nur trübes Licht, welches den Raum nicht gänzlich ausleuchten konnte. Außerdem fiel noch Licht durch das kleine Dachfenster. In Regalen waren verschiedene Kartons gestapelt. Darin Sachen, die darauf warteten, irgendwann einmal wieder eine Rolle in dem Haus und in dem Leben der Personen zu spielen. Viele Dinge, die eigentlich nicht mehr gebraucht wurden, von denen sich meine Eltern aber doch noch nicht endgültig trennen konnten. Praktisches, Nützliches und Nostalgisches. Jeder Karton voller Erinnerungen. Mein ordentlicher Vater hatte die Kartons beschriftet. Ich fand einen Karton mit meinen alten Kinderbüchern und suchte ein paar schöne für Jette heraus. Auch mein alter Plattenspieler stand in einem der Regale. Ob der überhaupt noch funktionierte? Ein Karton beherbergte meine alte Steinsammlung und auch Strandspiele waren ordentlich aufbewahrt.
Nach einiger Zeit hatte ich genug von der Flut der Eindrücke aus vergangenen Tagen und stieg die alte Treppe im Halbdunklen wieder hinab. Fast schon unten angelangt, stolperte ich über eine lose Stufe und das Brett fiel herunter. Nur dadurch sah ich das Versteck. In der Vertiefung der Stufe lag ein Ordner. Warum versteckt jemand einen Ordner unter einer Stufe? Verdattert setzte ich mich auf die Treppe und betrachtete den Ordner. Es waren handschriftliche Aufzeichnungen. Die Schrift erkannte ich sofort. Es war die Schrift meines Großvaters Alexander. Eine unverkennbare Schrift. Nicht die heutige lateinische Schreibtisch, kein Sütterlin, keine deutsche Kurrentschrift. Irgendeine Mischung aus allem mit leichter Rechts- Neigung, spitzen Winkel und absolut schnörkellos.
Eine rechtslastige Schrift ordnen Graphologen den warmherzigen, ungezwungenen und kontaktfreudigen Menschen zu. Das passt, dachte ich, genauso hatte ich meinen Großvater bislang empfunden und eingeschätzt. Nur leserlich war diese Schrift überhaupt nicht. Beim ersten Überfliegen konnte ich rein gar nichts erkennen. Nur die Blätter, die er für seine Niederschrift genutzt hatte, erkannte ich sofort. Es waren alte, ausgemusterte Zeugnisse der Landwirtschaftlichen Berufsschule, die mein Vater ihm als Schmierpapier gegeben hatte. Ich schmunzelte. Auf diesen Blättern hatte auch ich gemalt, gekritzelt und kleine Geschichten geschrieben.
Mit einigen Mühen konnte ich immerhin entziffern, was da auf meinen Knien lag. Es waren die Memoiren meines Großvaters. Warum versteckten meine Eltern die Aufzeichnungen meines Großvaters. Und vor wem?
Auch wenn ich vermutlich nicht der gewünschte Finder war, legte ich den Order nicht wieder in sein Versteck, sondern beschloss ihn heimlich mitzunehmen und zu lesen. Das würde kein leichtes Unterfangen werden, aber die Neugierde würde es möglich machen.
-
Unter Kaiser und Krieg
Henriette 1910 – 1919

Ein Jahrhundert vor Jette erblickte in der Hauptstadt Berlin ihre Ur- Großmutter Henriette das Licht der Welt. Sie wurde zuhause geboren, im Haus des Möbelfabrikanten Ernst Höhler und seiner Frau Charlotte. Es war ein großzügiges Haus am Olivaer Platz in der Nähe des Kuhdamms, einer wohlhabenden Wohngegend. Die Wohnung lag in der ersten Etage, der Beletage. Unten waren die Geschäftsräume des Möbelhandels. Die Räume hatten hohe Decken und ausgiebige Stuckverzierungen. Zur Straße lag der Salon mit einer großen Fensterfront, die Schlafräume waren nach hinten gelegen. Charlotte hatte vor dieser Entbindung eine Bauchhöhlen- Schwangerschaft erlitten und es war anfangs danach nicht klar, ob sie überhaupt Kinder bekommen könne. Sie selbst war in einer Großfamilie mit sechs Geschwistern aufgewachsen. Der Familie ging es finanziell ausreichend gut, trotzdem sorgte ihr Vater dafür, dass auch die Mädchen eine Ausbildung erhielten. Das war in der damaligen Zeit für Frauen nicht selbstverständlich. Charlotte wurde Schneiderin und sie nähte später viel für ihre Tochter und auch ihre Enkeltochter. Letzterer vermachte sie ihr Können. Charlotte wird als patente Frau beschrieben, doch bis dahin sollte es noch ein weiter Weg sein.
Die erste Zeit nach ihrer Eheschließung mit Ernst war nicht leicht für sie gewesen. Sie litt unter der Stille im Haus, die im Gegensatz zu ihrer Kinder- und Jugendzeit stand, in der durch die sechs Geschwister viel Trubel herrschte. Ernst war tagsüber nicht da, das Haus war groß und leer. Charlotte fühlte sich allein und einsam. So oft es ging, floh sie, suchte Zerstreuung in den Geschäften und Cafés auf dem Kuhdamm. Aber sie sorgte dennoch für einen standesgemäßen Haushalt. Sie kannte ihre Pflichten als Ehe- und Hausfrau.
Henriette war ein kleines, zartes Mädchen, das kaum reif schien für diese Welt. Auch wollte sie nicht sofort atmen. Der Arzt, der bei den ersten Wehen gerufen worden war, musste ihr leicht auf den Po schlagen und sie sogar in einen eilig herbei geholten Eimer mit kaltem Wasser tauchen, bis sie endlich den ersten Atemzug tat und schrie. Erleichtert übergab der Arzt das Kind der Hebamme, die es wusch, vermaß und in warme Tücher hüllte. Sie wollte das Kind in die Arme der Mutter legen, doch Charlotte wandte sich ab. Sie war zu müde, die Wehen hatten sie zu sehr angestrengt und geschwächt. Also übergab die Hebamme das Mädchen dem Kindermädchen. Emilie Gurtler war schon im Laufe der Schwangerschaft eingestellt worden und wartete begierig auf das kleine Bündel. Verzückt betrachtete sie es und versprach ihm, leise flüsternd, es ewig zu behüten und zu lieben. Die kleine Henriette, die bis eben noch laut geschrieen hatten, wurde still und schien die angebotene Geborgenheit anzunehmen.
So kam es, dass Henriette zunächst mit zwei Müttern aufwuchs. Charlotte war die gestreng auf die Erziehung, Sauberkeit und Kleidung achtende biologische Mutter, die wenig Herzliches und Mütterliches hatte. Und Emilie, die liebevolle, fürsorgliche, aber angestellte Mutter.
Die biologische Mutter war selten bei dem Kind. Es war in der damaligen Zeit noch nicht üblich, viel Zeit mit seinem Kind zu verbringen. Füttern, Wickeln und Zubettbringen waren die typischen Aufgaben der Kindermädchen, die damit ganz automatisch zu Hauptbezugspersonen wurden. Auch fühlte sich Charlotte schnell überfordert, wenn das Kind schrie und war unsicher, ob sie alles richtig machen würde. Sie hatte keinerlei Erfahrung im Umgang mit Kindern. Als Nesthäkchen war sie verwöhnt und von allen vergöttert worden. Ihre Geschwister waren für ihre Belange zuständig, nicht umgekehrt. Einzig das Ausfahren des Kindes in dem schicken vierrädrigen Korbkinderwagen, der jetzt so modern war, entlang des Kuhdamms oder durch den Grunewald, bereitete ihr Freude. Wenn Bekannte in den Kinderwagen schauten und das hübsche kleine Mädchen bewunderten, wuchs in ihr so etwas wie mütterlicher Stolz.
Liebe und Fürsorge erfuhr Henriette durch Emilie. Sie fütterte das Mädchen, wiegte es in den Schlaf und trug es umher, wenn es Bauchschmerzen hatte. Stundenlang saß sie an der Wiege, flüsterte zärtlich seinen Namen, wobei sie meist die zärtliche Koseform „Jetti“ benutzte. So war sie es auch, der das erste Lächelns des Mädchens galt. Und ihr wird auch das erste Wort Henriettes gegolten haben.
Aber es gab natürlich noch einen Menschen im Leben von Henriette. Den Vater Ernst. Wie in der damaligen Zeit üblich, war er nicht bei der Geburt dabei gewesen. Er war vor den Schmerzensschreien seiner Frau in das Herrenzimmer geflohen. Ein durch die Holzvertäfelung dunkler Raum, in dessen Mitte eine Sitzgarnitur aus schweren Ledermöbeln und unter dem Fenster ein großer Holzschreibtisch stand. Unruhig war er auf und ab gegangen, bis es an der Tür klopfte. Als ihm schließlich das Mädchen gezeigt wurde, überflutete ihn ein großes Glücksgefühl. Vielleicht hätte er enttäuscht sein müssen, dass es kein männlicher Erbe für die Möbelfabrik war. Aber solche Gedanken kamen ihm beim Anblick der kleinen Tochter nicht. Er war fasziniert von ihrem kleinen Gesicht, den kleinen Fingerchen und dem leichten Flaum auf dem Kopf. Immer wieder ging er in das Kinderzimmer und betrachtete das kleine Mädchen, wenn es schlief. Er sah zu, wie Emilie es fütterte und wickelte. Oder er hörte zu, wie Emilie abends für Henriettes sang. Sie kannte die meisten Texte der Kinderlieder nicht, die Melodien konnte sie jedoch sicher summen, Und Ernst genoss das friedliche Bild des lauschenden Kindes. Ganz sacht erlag auch er der schönen Stimme von Emilie.
Für die 17- jährige Emilie war das Leben im Hause der Familie Höhler ein Glücksgriff. Sie war aus der vorpommerschen Stadt Anklam in die Hauptstadt gekommen, um sich eine Anstellung zu suchen. Der elterliche Hof hatte nicht genug abgeworfen um die elfköpfige Familie satt zu bekommen. Schon frühzeitig hatte sie sich als älteste Tochter des Hauses um die jüngeren Geschwister kümmern müssen und so lag es nahe, sich als Kindermädchen zu bewerben. Obwohl in der Großstadt alles fremd war, hatte sie sich schnell einleben können. Sie genoss das vornehme Stadthaus der Familie Höhler mit all seinen Annehmlichkeiten. Insbesondere das eigene Zimmer, das sie dort hatte. Auch wenn es nur eine kleine Kammer war. Aber es war ein eigenes Zimmer, das sie mit niemanden teilen musste. Sicherlich flößte Charlotte als Hausherrin ihr Respekt ein, sie hatte sogar ein bisschen Angst vor ihr, aber es war, so vermutete sie, ein ganz normaler Zustand für das Verhältnis einer Angestellten zur Hausherrin. Außerdem machte die kleine Henriette dieses Unbehagen vollkommen wett. Sie liebte dieses kleine zarte Wesen. Genoss sein Zutrauen und freute sich an seinem Gedeihen.
Anfangs fand sie es verwunderlich, dass Ernst abends zu ihnen in das Kinderzimmer kam. Sie fühlte sich beobachtet und kontrolliert. Aber bald merkte sie, als seine Besuche immer regelmäßiger wurden, dass er die Stimmung in dem Kinderzimmer genoss.
So wunderte sie sich auch eines Abends nicht mehr, als sich die Tür öffnete und Ernst das Zimmer betrat. Sie summte gerade ein Abendlied, doch statt sanft in den Schlaf zu gleiten, stand Henriette in ihrem Bettchen, hielt sich an den Gitterstäben fest und hörte mit großen wachen Augen zu, leicht den Körper nach dem Gesang wippend.
Als sie ihren Vater sah, lächelte sie und versuchte in die Händchen zu klatschen. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und landete auf ihrem dick in Windeln gewickelten Po. Ernst trat an das Bett, hob seine Tochter heraus und setzte sich mit ihr auf einen Sessel.
„Singen Sie doch weiter. Sie haben eine wunderschöne Stimme“, forderte er Emilie auf. Diese errötete und fing mit leicht zittriger Stimme wieder an zu summen. Langsam wurde ihre Stimme wieder fester.
Als sie geendet hatte, sprach Ernst erneut „Sie haben wirklich eine schöne Stimme. Wurde bei Ihnen zu Hause viel gesungen?“
„Nein, eigentlich gar nicht. Zu Hause war immer so viel Arbeit, der Hof, wir neun Kinder, da gab es keine Momente, in denen man auf die Idee kam, zu singen. Daher kenne ich auch nur sehr wenige Lieder und schon gar nicht die Texte. Aber ich mag Musik.“
Ernst wandte sich an seine Tochter. „Und Du, genießt Du auch den Gesang? Hattest Du einen schönen Tag?“ Henriette strahlte ihren Vater an. „Jetzt geht der Tag aber zu Ende und Du gehörst in Dein kleines Bett“. Mit diesen Worten übergab Ernst das Kind Emilie, küsste es noch auf die Stirn und verließ das Zimmer.Am nächsten Abend betrat er wieder den Raum. „Ich habe etwas für Dich“ sagte er zu Henriette, die gerade auf dem Teppich saß und versuchte, ihrem Teddy einen Arm auszureißen. Er übergab ihr ein Päcken und sofort begann Henriette, das Einwickelpapier aufzureißen. „Eigentlich ist es eher ein Geschenk für Sie“ wandte er sich an Emilie. Es war ein Buch. „Die schönsten deutschen Kinderlieder“. Mit Noten und Texten. Dass sie mit Noten gar nichts anzufangen wusste, hatte er nicht bedacht, aber genau in diesem Moment wurde es ihm bewusst. Er räusperte sich. „Zusammen werden wir wohl auch die Melodien hinbekommen“. Er beugte sich zu Henriette hinab, gab ihr einen Kuss und ging.
Am kommenden Sonntag wollte Emilie gerade mit Henriette im Kinderwagen das Haus verlassen, um in der Nachmittagssonne einen Spaziergang zu machen, als Ernst zu ihnen trat. „Meine Gemahlin hat eine Einladung bei ihren Freundinnen zum Kaffee. Ich begleite sie auf dem Spaziergang“. Es war keine Frage, sondern eine Feststellung und so gingen sie gemeinsam los. Emilie schob den Kinderwagen. Es war ein kalter, aber trockener und sonniger Januartag. Erst gingen sie schweigend, aber dann bat er Emilie von ihrer Familie zu erzählen. Und sie erzählte. Von dem kleinen Hof mit zwei Kühen, eine hatte im letzten Sommer gekalbt. Von den paar Schweinen und einer Handvoll Hühner. Täglich musste der Stall ausgemistet werden. Im Sommer wurde Gras mit einer Sense gemäht. Und wenn es regnete, bevor das Heu eingeholt war, war die ganze Arbeit vergebens. Im Winter wurde mit Holz geheizt, dafür mussten Bäume gefällt und aus dem Wald zum Hof geschafft werden. Schon die kleinsten Kinder mussten mithelfen. Die Mutter war geschwächt, zwölf Schwangerschaften, davon drei Fehlgeburten, hatten ihrem Körper zugesetzt. Der Vater immer voller Sorge. Es war eine traurige Schilderung über ein hartes Leben.
„Dann gefällt es Ihnen bei uns?“ „Oh ja“ antwortete Emilie und sie gingen schweigend weiter. Trafen sie andere Familien, grüßte Ernst, indem er seinen Hut hob. Für Emilie war es ein unwirklicher Nachmittag.Parallel dazu lief das geordnete und gesittete Leben des Ehepaares Höhler. Auf den wenigen, vor Bombenkrieg und über die Flucht geretteten Fotos ist die kleine Familienwelt zu betrachten. Auf einem Foto sitzt die kleine, etwa sieben Monate alte Henriette mit Windel an ein Kissen gelehnt, ein geknotetes Oberteil im römischen Stil tragend. Ein kleines, noch fast kahlköpfiges Mädchen mit großen, strahlenden Augen. Eine Aufnahme einer Fotografin in der Leipziger Straße.
Ernst leitete die Möbelfabrik, Charlotte den Haushalt. Es wurden Einladungen gegeben, sie gingen gemeinsam ins Theater und in die Kirche. Ernst größte Freude war die Mitgliedschaft in der Rudergemeinschaft am Wannsee. Verbrachte er seine Zeit dort, genoss Charlotte den Nachmittagskaffee mit ihren Freundinnen.Es war keine Liebesheirat gewesen. Charlotte war eine hübsche, repräsentative Frau, Ernst eine gute Partie. Man begegnete sich mit Respekt und Würde. Liebe und Leidenschaft waren von untergeordneter Bedeutung. Hinzu kam, dass der Arzt Charlotte von einer zweiten Schwangerschaft abgeraten.
Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Ernst für die Reize von Emilie empfänglich war. Er war ein lebensfroher Mensch und er sehnte sich nach Zärtlichkeit und Liebe. Aber er war auch nicht leichtsinnig. Er war sich seiner Verantwortung im familiären, gesellschaftlichen und geschäftlichen Leben bewusst. Niemals hätte er seine Stellung leichtfertig aufs Spiel gesetzt.
Und so wäre vermutlich nichts passiert, hätte nicht ein Serbe namens Gavrilo Prinzip am 28. Juni 1914 den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo ermordet und damit den ersten Weltkrieg auslöst.Die Familie Höhler erreichte die Nachricht über den Kriegsausbruch in Ahlbeck auf Usedom, wo sie ihren Sommerurlaub verbrachten. Man war mit der Bahn angereist. Eine lange und umständliche Reise. Dennoch hatte sich Charlotte völlig umsonst Sorgen gemacht, ob die Fahrt für die vierjährige Henriette zu anstrengend sei, insbesondere, da sie schnell quengelte, wenn sie müde war. Aber die Fahrt war viel zu aufregend, die Vorfreude zu groß, sodass Henriette fröhlich und neugierig blieb.
Die Familie hatte sich in einem Hotel an der Strandpromenade eingerichtet. Noch heute sind die Jugendstilvillen dort Zeugen dieser Zeit. Direkt gegenüber lag die Seebrücke, auf der man meterweit in die Ostsee laufen konnte. Gleich am Abend der Ankunft wanderten sie über die Seebrücke und Henriette war begeistert von den Wellen und der Gischt, die unter ihr tobten. Überhaupt begeisterte sie alles. Alles war neu. Der kilometerlange feine Sandstrand, an dem Ernst mit ihr Burgen baute. Sie quietschte vor Begeisterung, wenn Ernst versuchte, sie im Sand einzubuddeln. Sie stand mit nackten Füsschen im Wasser und übersprang die Wellen, die an den Strand schlugen. Oder spielte Fangen mit ihnen, in dem sie ihnen nachlief und wieder vor ihnen weg. Sie sammelte mit überraschender Ausdauer mit Charlotte Muscheln und ließ sich von ihr im Strandkorb vorlesen, bis ihr vor Müdigkeit die Augen zufielen.Sie sah nicht die Schlagzeilen der Zeitungen. Dass Deutschland Österreich- Ungarn die bedingungslose Unterstützung zusagte. Dass Österreich- Ungarn am 28. Juli 1914 dem Königreich Serbien den Krieg erklärte. Bekam nicht mit, wie sich Deutschland in den Krieg katapultierte und sah nicht die dunklen Wolken, die tief am Horizont über Europa hingen. Die einzigen Wolken, die sie sah, waren die Wolken eines Gewitters, das am Vorabend der Abreise über Usedom tobte. Die drei waren auf ihrem Zimmer, das Fenster stand offen, als plötzlich immer stärkerer Wind aufkam, der die Gardinen wehen lies. Die Fensterläden wurden hin und her gerüttelt, es schepperte und klapperte. Sturzartig schlug der Regen gegen das eilig geschlossene Fenster. Der Himmel wurde von Blitzen über dem Meer erleuchtet und Donner krachten über ihnen herein. „Da draußen ertrinkt die Welt“, sagte Charlotte und keiner von den Erwachsenen konnte schon ahnen, wie recht sie mit dieser Aussage hatte.
Ernst musste kämpfen. In der 5. Armee, die sich zunächst unter General- Oberst Moltke auf einer Linie von Metz Richtung Verdun vor grub. Nach anfänglichen Erfolgen glaubte man an einen kurzen und schnellen Eroberungssieg und in der Heimat jubelten die Menschen in ihrem Siegestaumel. Doch bereits im September 1914 blieb der deutsche Angriff im Schlamm der Schützengräben der Westfront stecken. Unter Anweisung der Generäle, für die das Ganze eine Art Strategiespiel im Warmen und Trockenen ihrer riesigen Schreibtische war, wurde um jeden Meter gekämpft. Ging es einen Schützengraben weiter vor, so musste kurzerhand wieder der Rückzug angetreten werden. Auf dieser nahezu erstarrten Frontlinie verloren Tausende von Soldaten auf beiden Seiten ihr Leben.
Ernst sah den Tod. Er sah ihn, hörte ihn und roch ihn. Bei seinem ersten Heimaturlaub im Dezember 1914 war er ausgehungert nach Leben und Liebe. Die Mauer aus Vernunft zwischen ihm und Emilie brach sofort in sich zusammen. Er liebte sie. Vorsichtig und sanft. Er ließ ihr Haar durch seine Finger gleiten, fuhr mit den Fingerkuppen ihren Gesichtskonturen entlang und spürte ihre Lippen auf den seinen. Er liebkoste ihren Hals, streichelte ihre Brüste und bedeckte ihren Bauch mit Küssen. Die Innenseite ihrer Schenkel fuhr er zärtlich hoch. Als sie sich vereinten, vergaßen beide für kurze Zeit das Grauen um sie herum, den Krieg, den Tod, ihre Herkunft und ihre Zukunft. Für kurze Zeit stand die Welt für sie still.Charlotte bekam von alledem nichts mit. Vielleicht sah sie weg, vielleicht war sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie hatte während der Abwesenheit von Ernst dem alten Höhler bei der Leitung der Möbelfabrik geholfen. Ausgerechnet in diesem Jahr hatte der alte Höhler einen Schlaganfall erlitten und brauchte ihre Hilfe. Und so hatte sich Charlotte eingearbeitet. Eine Frau aus einfachem Hause, die nur schneidern gelernt hatte und die sich in den letzten Jahren nur mit Mode und Gesellschaft beschäftigt hatte.
Sie wuchs an den Aufgaben und damit wuchs ihr Stolz und ihr Selbstbewusstsein. Die Belastung brachte ihre Stärke hervor.
Es machte es Spaß, mit dem alten Höhler über Zahlen und Schriften zu hocken. Sie hatte sich das Rauchen angewöhnt und abends ließen die Geschäftsleute den Tag mit einer Zigarette ausklingen. So ist es denkbar, dass sie von der kurzen und intensiven Liebe zwischen ihrem Gatten und dem Kindermädchen nichts wahrnahm.Als Ernst das nächste Mal nach Hause kam, war es April 1915. Diesmal kam er für immer. Ein Geschoss hatte seinen rechten Arm zerfetzt. Der Arm wurde noch in der Champagne in einem Lazarett amputiert. Niemals wieder würde sich Ernst an einem guten Champagner mehr erfreuen können. Der Krieg war damit für ihn vorbei. Welch Glück, denn so hatte er ihn im Gegensatz zu Tausend anderen überlebt. Aber Ernst nahm dieses Glück nicht sofort wahr. Die Wunde hatte sich entzündet. Fieber wütete in seinem Körper. Er war geschwächt und apathisch. Wieder zeigte Charlotte Stärke. Sie pflegte ihn, verband seine Wunde, wusch und fütterte ihn. In den Zeiten, in denen er schlief, ging sie weiter den Geschäften der Fabrik nach. Langsam erholte sich Ernst und nahm Gewahr, dass Emilie nicht mehr da war.
„Wo ist Emilie?“ fragte er seine Frau.
„Sie ist fortgegangen, um zu heiraten. Im letzten Monat brachte sie einen jungen Mann mit. Ich glaube, er ist Kommunist. Sie sagte, sie erwarte ein Kind von ihm und bat um ihre Entlassung“.Ernst traf es wie einen Schlag, doch er zeigte es nicht. Für ihn blieben viele Fragen offen. Liebte Emilie diesen Mann? War das Kind, das sie erwartete, sein Kind? Was wusste Charlotte? Aber darüber konnte er mit seiner Frau natürlich nicht sprechen. Sie sprachen nie wieder über Emilie. Nur über ein neues Kindermädchen.
„Möchtest Du ein neues Kindermädchen einstellen?“ fragte Ernst seine Frau. „Nein, ich denke nicht. Für Henriette beginnt bald das Schulleben und bis dahin können wir sie erziehen. Ich denke, das Hausmädchen als Hilfe reicht.“So war auch aus Henriettes Leben die liebevolle Emilie verschwunden. An ihre Stelle trat nun endlich die richtige Mutter. Charlotte begann mit fünf jähriger Verspätung ihre Mutterrolle anzunehmen. Zwar nicht so liebevoll und zärtlich, wie es Emilie getan hatte, sondern weiterhin streng und eher unnahbar. Aber sie kümmerte sich um Henriette, erzog sie zu einer kleinen ordentlichen Dame, die wusste, wie man sich bei Tisch und in der Gesellschaft zu benehmen hat. Die lustige und unbeschwerte Seite von Henriette blieb jedoch Ernst vorbehalten. Dieser hatte die Geschäfte der Möbelfabrik wieder übernommen. Sie forderten ihn in der angeschlagenen wirtschaftlichen Lage sehr. Seinen Ausgleich holte er sich bei seiner Tochter. Sie gaben sich gegenseitig Freude und Vergnügen und Ernst fand den Weg zurück ins Leben.
Auch aus dieser Zeit ist noch eine Fotografie erhalten. Es zeigt die Familie Ernst Höhler im Jahr 1916. Charlotte, inzwischen ein bisschen fülliger geworden, eine stattliche Frau im langen schwarten Rock und glänzender schwarzer Bluse mit weißem Spitzenkragen. Die dunklen Haare zu einem strengen Knoten aufgesteckt. Ernst groß und schlank, eine Tolle in den schwarzen Haaren mit einem Oberlippenbart. Er trägt einen dunklen Anzug mit breiter Krawatte und weißem Hemdkragen. Henriette in weißem Rock, blauem Jäckchen und weißer Bluse mit großem Kragen. Die strohblonden, kinnlangen Haare gelockt, mit großer weißer Schleife auf dem Scheitel. Ein hübsches kleines Mädchen mit artiger Ausstrahlung. Auf dem Bild ist vom ersten Weltkrieg nichts zu ahnen. Von Emilie Gurtler ebenfalls nicht. Ernst steht seitlich gedreht, vor ihm seine Tochter, die den Armstumpf völlig überdeckt. Ein Bild einer heilen Familie in einer heilen Welt.
Henriette blieb auch als Schulkind ein schmales blasses Mädchen, das auf den erhaltenen Fotos wie durchsichtig erscheint. Auf einem der Fotos, auf dem sie den damals üblichen Matrosen- Anzug trug, schließlich wollte der Kaiser eine große Flotte, wirkt sie wie verloren. Ein weiteres Foto zeigt Henriette und Charlotte, als diese acht Jahre alt war. Henriette trägt ein weißes Spitzenkleid, wieder mit großer Schleife im leicht gelockten blonden Haar. Das Gesicht hatte sich gestreckt, blieb aber blass. Die Augen groß und dunkel. Ein zartes, zerbrechliches Kind.
Sie wurde mit sieben Jahren eingeschult und ging in die Fürstin- Bismarck- Schule in der Sybelstraße. Die Schule war 1857 als höhere Mädchenschule gegründet worden. Auf diese Schule gingen viele jüdische Mädchen. Noch im hohen Alter erinnerte sich Henriette immer wieder daran, dass sie siebzehn Jüdinnen in der Klasse hatte. Dabei hatte sie eine ganz besondere Art, die Zahl siebzehn zu betonen. Was sie mir mit dieser immer wieder gemachten Äußerung klar machen wollte, blieb mir lange unklar. Adolf Hitler war noch entfernt und doch spielte Antisemitismus schon eine große Rolle. „Die reichen Juden“ lösten viel Neid bei den Deutschen aus. Waren die Juden keine Deutsche? Ich lernte letztens einen älteren Herren mit ausländischen Namen kennen. Auf meine Frage, aus welchem Land er stamme, antworte er mir, er sei Jude. Dabei hatte ich doch gar nicht nach seiner Religionszugehörigkeit gefragt.
Im Internet rühmt sich die alte Schule von Henriette heute damit, dass sie viele jüdische Schülerinnen hatte. Heute ist man stolz darauf.
Henriette war den Kontakt mit Gleichaltrigen nicht gewohnt und tat sich anfangs schwer. Mit der Zeit entwickelte sie jedoch Freundschaften. Besonders zur adligen Lilli, die in der Schule neben ihr saß. Diese Freundschaft wurde sehr eng. Dazu kam noch ein Mädchen namens Luise und so wurden sie ein Freundinnen- Kleeblatt.
Morgens wurde Henriette vom Hausmädchen der Familie Höhler zur Schule gebracht, mittags nahm Ernst, der zum Mittagessen nach Hause ging, sie mit. Die Nachmittage verbrachte sie viel mit Charlotte, die immer mehr Interesse für ihre Tochter aufbrachte. Je älter Henriette wurde, um so mehr konnte sie mit ihr anfangen. Sie gingen spazieren, flanierten den Kuhdamm entlang oder gingen ein Stück Kuchen essen. Außerdem waren die Nachmittage gefüllt mit Klavierunterricht und Tanzstunde. Charlotte blieb weiter eine strenge, aber liebevollere Mutter, die auf die gute Bildung ihrer Tochter achtete.
Die Schule wurde von dem älteren Oberstudiendirektor Dr. L. geführt. Auch die anderen Lehrer waren entweder älter oder invalide. Gesunde junge Männer gab es in Berlin nicht mehr. Die, die noch lebten waren an der Front. Dr. L. glaubte noch an den deutschen Sieg und so glich der Unterricht im Kommandoton eher dem Drill in einer Kaserne. Hauptinhalt waren Durchhalte- Parolen, die mittlerweile paradox angemutet haben mussten. Denn der erste Weltkrieg war längst in Berlin angekommen. Die Engländer hatten die Seeblockade verschärft, woraufhin die Deutschen den totalen U- Boot- Krieg erklärt hatten. Nachdem die Deutschen auch amerikanische Schiffe versenkt hatten, hatte Amerika im April 1917 den Deutschen den Krieg erklärt und es wurde immer enger für die Deutschen. Die Menschen hungerten und froren. Lebensmittel gab es nur auf Zustellung, vor den leeren Geschäften wurden die Schlangen immer länger.
Eine ernste Schulzeit. Keine unbeschwerte Kinderzeit. Henriette sah sich in einer Welt voll gekrümmter Erwachsener mit ernsten Gesichtern. In mitten von Angst und Sorgen. Eine Kindheit ohne Lachen, eine Kindheit mit ständigem Hunger. Nie würde Henriette die Zuckerrüben- Zeit vergessen.
Im Oktober 1918 bat Deutschland um Waffenstillstand. Dies war die Geburtsstunde der Dolchstoßlegende, denn schließlich hatte man nicht durch die Besiegbarkeit des deutschen Heeres verloren, sondern durch die revolutionären, sozialistischen und kommunistischen Parolen der Opposition in der Heimat. Diese „Vaterlandslosen“ fielen dem deutschen Soldaten, der sein Leben für das Vaterland einsetze, in den Rücken.
Am 09. November 1918 wurde die Weimarer Republik ausgerufen und am 28.11.1918 dankte Kaiser Wilhelm der II ab, nachdem die USA dies zur Bedingung gemacht hatten, um den Waffenstillstand zu akzeptieren.
1919 wurde in der Pariser Friedenskonferenz im Schloss von Versaille Deutschland und seinen Verbündeten die alleinige Verantwortung für den Ausbruch des ersten Weltkrieges zugeschrieben und mit Gebietsabtretungen sowie Reparationszahlungen belegt. Die Reparationszahlungen hatten eine Höhe, die Deutschland nicht leisten konnte. Statt des ersehnten Friedens im Wohlstand kamen nun Armut und Hunger. Das deutsche Volk fühlte sich getreten und gedemütigt, dachte sehnsüchtig an die glorreichen Zeiten unter Kaiser Wilhelm zurück und machte die Demokratie für den Untergang verantwortlich. Mit Ausbrechen der Weltwirtschaftskrise, als sich die Lebensbedingungen der Menschen immer weiter verschlechterten, wurde in Zusammenhang mit der immer wieder belebten Dolchstoßlegende und dem zunehmenden Judenhass, der Weg für Hitler geebnet.
Henriette erlebte das Kriegsende zu Hause mit ihren Eltern. Am Fenster stehend sahen sie auf die Straße hinunter, wo die Menschenmenge jubilierte. „Endlich ernten die Arbeiterklassen die Früchte ihrer langjährigen Arbeit. Jetzt wird alles besser!“, rief ein Mann auf einem Podium stehend in die Menge. „Wird jetzt wirklich alles besser?“ fragte Henriette ihren Vater. „Ich weiß es nicht“, antwortete Ernst. Aber es schien, als glaubte er nicht daran.